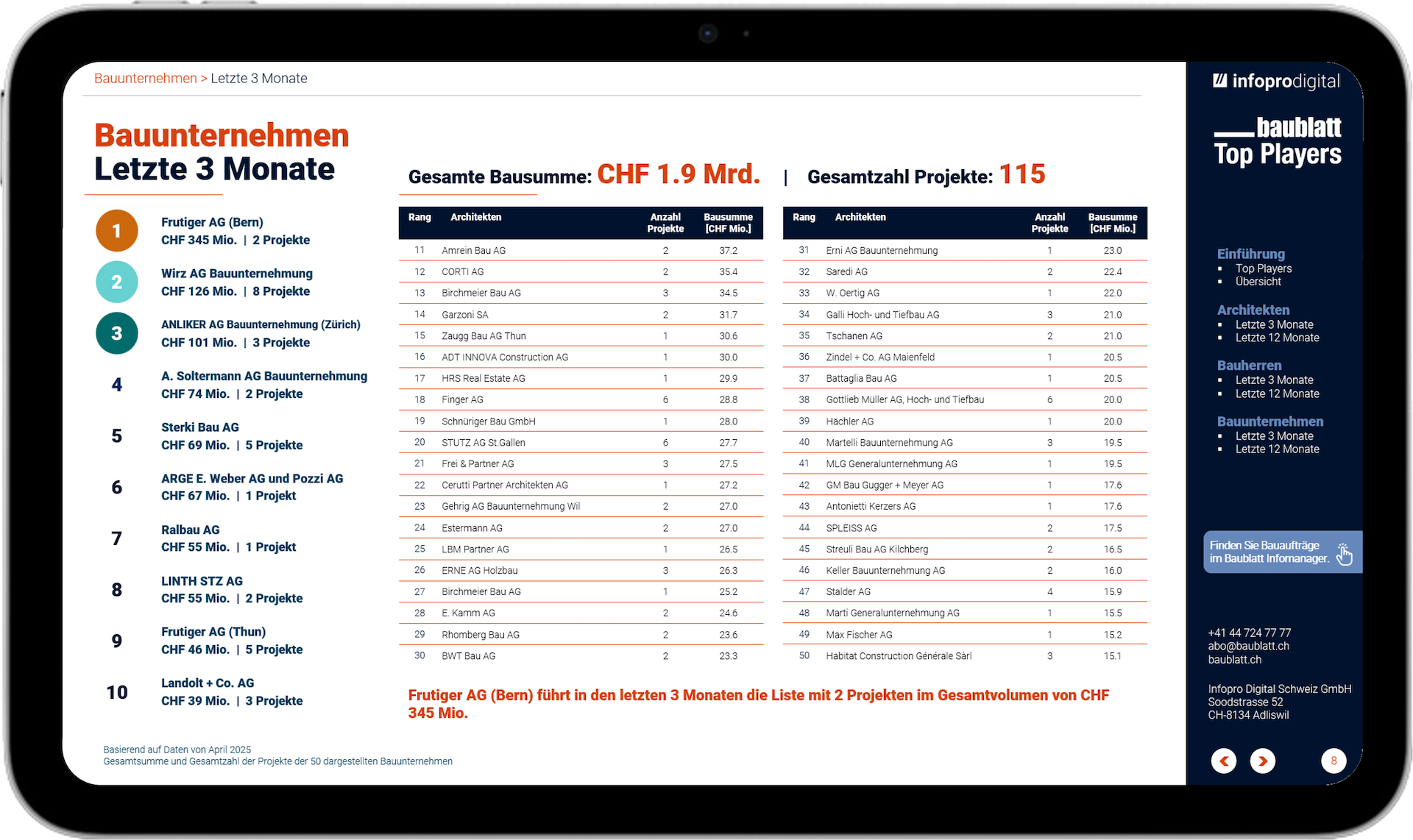Wie die SBB Hitzeschäden und andere Notfälle beheben
Mit anhaltenden Hitzeperioden im Sommer haben auch die Schweizerischen Bundesbahnen zunehmend zu kämpfen: Gleise und andere Anlagen können Schäden erleiden. Wie eine durch hohe Temperaturen verformte Schiene geflickt und andere brenzlige Situationen entschärft werden, präsentierten die SBB vor Kurzem den Medien.

Quelle: Simone Matthieu
Ein Lösch- und Rettungszug befährt mit dem Gleiskühlsystem zu Demonstrationszwecken die Schienen am Depot in Olten. Mehrere Durchgänge senken die Temperatur der Schienen so weit, dass sie über Nacht geflickt und am nächsten Morgen wieder befahren werden können.
Fünf Zentimeter. Verformt sich eine Schiene über
diesen Abstand auf die Seite, spricht man bei den SBB von einer Verwerfung.
Meist entsteht dieser Schaden durch extreme Temperaturen, denen die Geleise
ausgesetzt sind. An vielen Stellen liegen sie schliesslich den ganzen Tag über ungeschützt in der Sonne. In der Regel sind es Lokführerinnen und Lokführer, die als Erste bemerken, wenn
sie über eine verbogene Schiene fahren. Viele von ihnen sehen die Verformung
bereits vor der Durchfahrt mit ihrem geübten Blick. Zudem prüfen Streckenläufer
regelmässig die Fahrbahn auf ihren Zustand.
Selbstverständlich entsteht eine Verwerfung nicht von heute auf morgen. Die Stelle verzieht sich über lange Zeit. Kommt es zu dann einer der seltenen Verwerfungen – drei bis sieben Mal pro Jahr im ganzen Streckennetzt - reagieren die SBB nach eigener Darstellung umgehend. Die Sicherheit für Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende habe stets oberste Priorität bei den Schweizerischen Bundesbahnen, wie sie vor Kurzem an einer Medienkonferenz in Olten erklärten.
Das kühlende Nass
Gibt der Lokführer die Schwachstelle an die Zentrale durch, fährt ein Lösch- und Rettungszug (LRZ) des SBB-eigenen Interventionsteams zum betreffenden Ort, um erste Massnahmen einzuleiten. Das heisst, er sprüht mit einer Konstruktion, die unten am Gefährt angebracht ist, kühles Nass auf das betroffene Schienenteil. Dieses kann nach einem Tag in der Hitze bis zu 60 Grad heiss werden. «Mehrere Fahrten mit dem Lösch- und Rettungszug über den Schaden sind nötig, um ihn ‹einzufrieren› und so weitere Mängel zu verhindern», erklärt Simon Fürst, Flächenleiter der Intervention Region Ost. Dieses «Einfrieren» dauere schon mal bis zu zwei Stunden, fügt er an. Im Depot des Bahnhofs Olten demonstrierten die SBB den Medienschaffenden, wie ein Lösch- und Rettungszug mit 48‘000 Litern Wasser an Bord seine Arbeit ausführt.

Quelle: zvg
Ein Lösch- und Rettungszug unterwegs. Die Spezialgefährte sind an den 15 Standorten des SBB-Interventionsteams über die ganze Schweiz verteilt stationiert.
Die Verwerfung eines Gleisstücks lässt sich erst ab einer Eigentemperatur von 25 Grad reparieren. Einmal abgekühlt, wird es dafür aus der Schiene herausgeschnitten, die Schnittstellen maximal fixiert. «Im besten Fall begradigen wir die Verwerfung über Nacht und schweissen sie wieder ein, so dass der Zugverkehr am nächsten Tag den gewohnten Verlauf nehmen kann», sagt Fürst. Sie würden immer wieder gefragt, ob bei drohenden Hitzeperioden das gesamte Schienennetz präventiv gekühlt würde, ergänzt Erich Emmenegger, Fachbereichsleiter Fahrbahn Region Mitte. «Das tun wir nicht, das wäre ein viel zu grosser Aufwand für einen geringen Nutzen.»
Das Rettungsteam der Bahn
Die SBB-Intervention ist eine eher neuere Einsatzorganisation der SBB. Von den 1960-Jahren an nahmen sich Bähnler in einem Milizsystem den Notfällen auf und an den Gleisen an. Seit 2006 ist das Interventionsteam professionalisiert – gewissermassen als die Feuerwehr der Bahn. Die Mitglieder arbeiten Vollzeit und bringen idealerweise Erfahrungen als Lokführerin oder aus der Feuerwehr mit. Für die SBB-spezifischen Aufgaben schult sie ihr Arbeitgeber intern. 350 Bahnrettungsspezialisten sind landesweit auf 15 Standorte. An jedem steht jeweils ein Lösch- und Rettungszug (LRZ) bereit. Die SBB-Rettungskräfte arbeiten in 24-Stunden-Schichten und schlafen an den Stützpunkten, die somit Tag und Nacht besetzt sind. «Sollte etwas passieren, sind wir in fünf Minuten bereit zum Ausrücken», erklärt Fürst. «Innerhalb von 45 bis 60 Minuten erreichen wir jeden Ort im Schweizer Schienennetz.»

Quelle: Simone Matthieu
Im Führerstand eines Lösch- und Rettungszuges der SBB bedient eine Person die Lok, während die andere die Geräte des Zugs koordiniert sowie den Kontakt zu Zentrale und Behörden hält.
Nebst dem Sprühen von Wasser hat der Lösch- und Rettungszug zahlreiche weitere Funktionen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es den Interventionsteams, auf praktisch jede Art von Störung im Eisenbahnnetz zu reagieren: «Wir sind stets die Ersten vor Ort.» Zweieinhalb Mal pro Tag rückt jeder Lösch- und Rettungszug durchschnittlich aus. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich: Vom Wegräumen überfahrener Tiere, dem Einspuren entgleister Waggons über das Abschleppen fahrunfähiger Züge bis zur Sicherung defekter Fahrleitungen reicht die Palette der Aufgaben.
Immer die Ersten vor Ort
Ebenfalls als Erste vor Ort sind die Interventionsteams bei Unglücksfällen, Personenschäden oder Bränden. So besitzt jeder LRZ am Dach der Führerkabine einen beweglichen Wasserwerfer, der bei offenem Feuer zum Einsatz kommt. «Wenn in Gleisnähe ein Gebäude brennt, kann die herkömmliche Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen manchmal nicht heranfahren», schildert Fürst. «Da braucht es uns, um von der Schienenseite her zu löschen. Wir unterstützen einander gegenseitig.» Wann immer auf SBB-Gelände ein Ereignis vorliegt, welches das Hoheitsgebiet des Kantons betrifft, arbeiten die Interventionsteams mit den Behörden zusammen. Beispiele dafür sind Unfälle oder Kollisionen.

Quelle: Simone Matthieu
Wenn die lokale Feuerwehr an einen Brand in Gleisnähe nicht gut herankommt, kommt er zum Einsatz: der Wasserwerfer auf dem Dach eines Lösch- und Rettungszugs.
Ein LRZ besteht aus drei Teilen. Den ersten bildet ein Tanklöschwagen mit einem Volumen von 48’000 Litern Wasser. Zusätzlich sind 1500 Liter Schaummittel an Bord, die bei Bedarf unters Wasser gemischt werden. Der zweite Teil ist ein Gerätefahrzeug. Für die verschiedenen Einsätze braucht es unterschiedlichste Werkzeuge. Neben einer Vielzahl von Instrumenten zur Brandbekämpfung und Rettung gehören dazu: ein Stromerzeuger, ein Atemluftkompressor mit Füllstation, eine Motorspritze, Ölwehrmaterial, Handfeuerlöscher, Scheinwerfer, Schienenrollwagen, ein hydraulischer Rettungssatz sowie eine Rettungskettensäge. Ebenfalls verfügen die Gerätefahrzeuge über Hilfskupplungen. Dies, um stehengebliebene Züge abzuschleppen. Spezielle Hilfswagen der SBB Intervention sind zudem im Falle entgleister Waggons mit einem Kran sowie Aufgleisgeräten ausgestattet. «Die reibungslose Reisekette auf dem SBB-Schienennetz sicherzustellen, ist unser Auftrag», erläutert Fürst.
Sanität und Feuerwehr auf Schienen
Der dritte und letzte Teil des Lösch- und Rettungszugs ist das Rettungsfahrzeug. Es steht unter Überdruck und wird durch eine Schleuse betreten, was sowohl das Interventionsteam als auch die Geretteten im Falle eines Tunnelbrandes vor Rauchvergiftungen schützt. Bis zu 60 Personen können mit diesem Gefährt evakuiert werden. Im Rettungsfahrzeug befinden sich Atemschutzgeräte für 20 Personen, die Brandschutzausrüstung der Mannschaft sowie Sanitäts- und Rettungsmaterial, wie etwa Tragebahren.
Der Führerstand ist mit zwei Personen besetzt: Links sitzt der Lokführer, rechts bedient eine zweite Person die am LZR montierten Geräte wie etwa den Wasserwerfer und hält Kontakt mit Zentrale und Behörden.

Quelle: Simone Mathieu
Atemschutzgeräte für 20 Personen, die Brandschutzausrüstung der Equipe sowie Sanitäts- und Rettungsmaterial für Gerettete: Fixe Bestandteile der Ausrüstung jedes Rettungswagens eines Lösch- und Rettungszugs.
Fürst schildert, wie sie Mitte April die Meldung erhalten hätten, eine Lokomotive im Gotthard-Scheiteltunnel sei in Brand geraten. Das ausgerückte Interventionsteam konnte den Brand schnell löschen, der Lokführer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung sicherheitshalber ins Spital transportiert. Bereits nach rund zweieinhalb Stunden sei eines der beiden Gleise im Tunnel der für die Löschung gesperrten Gotthard-Bergstrecke wieder für den Bahnverkehr frei gewesen.
Prävention zahlt sich aus
Auch wenn die LZR derart speditive Hilfe leisten - die SBB setzen laut Mediensprecherin Fabienne Thommen alles daran, solche Einsätze zu verhindern. Stichwort Prävention: Jährlich würden rund 10 bis 15 Millionen Franken allein für das Verhindern von Unfällen durch Naturgefahren eingesetzt rechnet Thommen vor. Dazu gehörten Schutzdämme, Steinschlagschutznetze, Felssicherungen und Alarmanlagen. In puncto Prävention spielten auch die Wassertankwagen der SBB-Unterhaltsdienste eine wichtige Rolle: Gemäss Thommen befeuchten sie Böschungen, spülen Sickerleitungen und kommen bei Schleifarbeiten zum Einsatz, um Brände zu verhindern. Die Massnahmen zeitigen Wirkung: Trotz der tendenziell steigenden Anzahl an Hitzetagen blieben die temperaturbedingten Störungen au dem SBB-Schienennetz im gleichen Zeitraum etwa konstant. Dazu sagt Thommen : «Wir lernen aus jeder Hitzeperiode.»

Quelle: zvg
Ein Lösch- und Rettungszug i einem Tunnel: Eies von drei Fahrzeugen eines LRZ ist mit luftdichten Schleusen und einem Atemschutzsystem extra für die Evakuierung von Fahrgästen bei einem Tunnelbrand konzipiert.