Regenwasser als Ressource: Der Regenwasserplan der Stadt Zürich
In der Stadt Zürich soll Regenwasser künftig nach dem Prinzip der «Schwammstadt» bewirtschaftet werden. Landschaftsarchitekt Gerhard Hauber, Partner bei Henning Larsen, stellte dem Baublatt im Gespräch die Ideen für diesen Plan vor.
Das deutsch-dänische Landschaftsarchitekturbüro Henning Larsen ist derzeit mitten in der Entwicklung des Regenwassermasterplans für die Stadt Zürich. Der Plan nach den Ideen der Schwammstadt – also einer Stadt, die Wasser speichert und durch Verdunstung kühlen kann – soll im Laufe des nächsten Jahres verbindlich werden.
Gerhard Hauber, Sie sind Landschaftsarchitekt und dabei, den
Regenwassermasterplan für Zürich zu planen. Welche Planungsparameter sind dabei
für Sie entscheidend?
Gerhard Hauber: Gerne möchte ich diese Thematik an zwei
Planungsbeispielen erläutern. Als Teil des Teams des Landschaftsarchitekturbüro
Ramboll Studio Dreiseitl, das Teil von Hennig Larsen wurde, gestalteten wir den
«Bishan Park» in Singapur. Er wurde ab 2012 umgebaut.
Die Stadt Singapur liegt auf einer Insel, etwa so gross wie
der Bodensee. Es regnet dort dreimal so viel wie in Zürich. Immer wieder
gab es Überschwemmungen, weswegen die Stadt in den siebziger Jahren eine
Entwässerungsinfrastruktur baute. Ein Netzwerk aus unglaublichen 7000 Kilometer
Kanälen aus Beton hatten die Funktion, Wasser aus der Stadt abzuleiten. Die
Naturressource Regenwasser ging dadurch verloren. Wenn Regenwasser den Boden
berührt, sollte man anfangen, es zu bewirtschaften. Nach Naturprinzipien
bewirtschaften heisst, es versickern oder verdunsten lassen. Dazu gibt es die
sogenannten «Nature based solutions». Das können beispielsweise einfache Mulden
sein, wo das Wasser versickern kann. Solche Mulden haben wir im Bishan Park, im
Zentrum von Singapur integriert.
Durch die Planung ohne Betonkanäle wurde auch die Biodiversität gefördert. Wichtige Naturprozesse finden zwischen der Pflanze, dem Wasser und dem Boden statt. Eine Vielfalt von Mikroorganismen bis hin zu Ottern, Vögeln, heimischen Pflanzen und Biotopstrukturen siedelten sich dort an. Extremsituationen schaffen eine zusätzliche Dynamik bei diesem System. Klassische Verlagerungsprozesse, bei denen Wasser die Erde erodiert, bieten Chancen für eine andere Art von Habitat. Beispielsweise entstehen dadurch wieder flache Ufer an denen Fische laichen können. Für solche «weichen Ufer» ist die Ingenieurbiologie gefragt. Bei einer Krainerwand beispielsweise sichern Holzstämme und Pflanzen die Ufer. Weidenstecklinge verwurzeln in diesen Ufern.
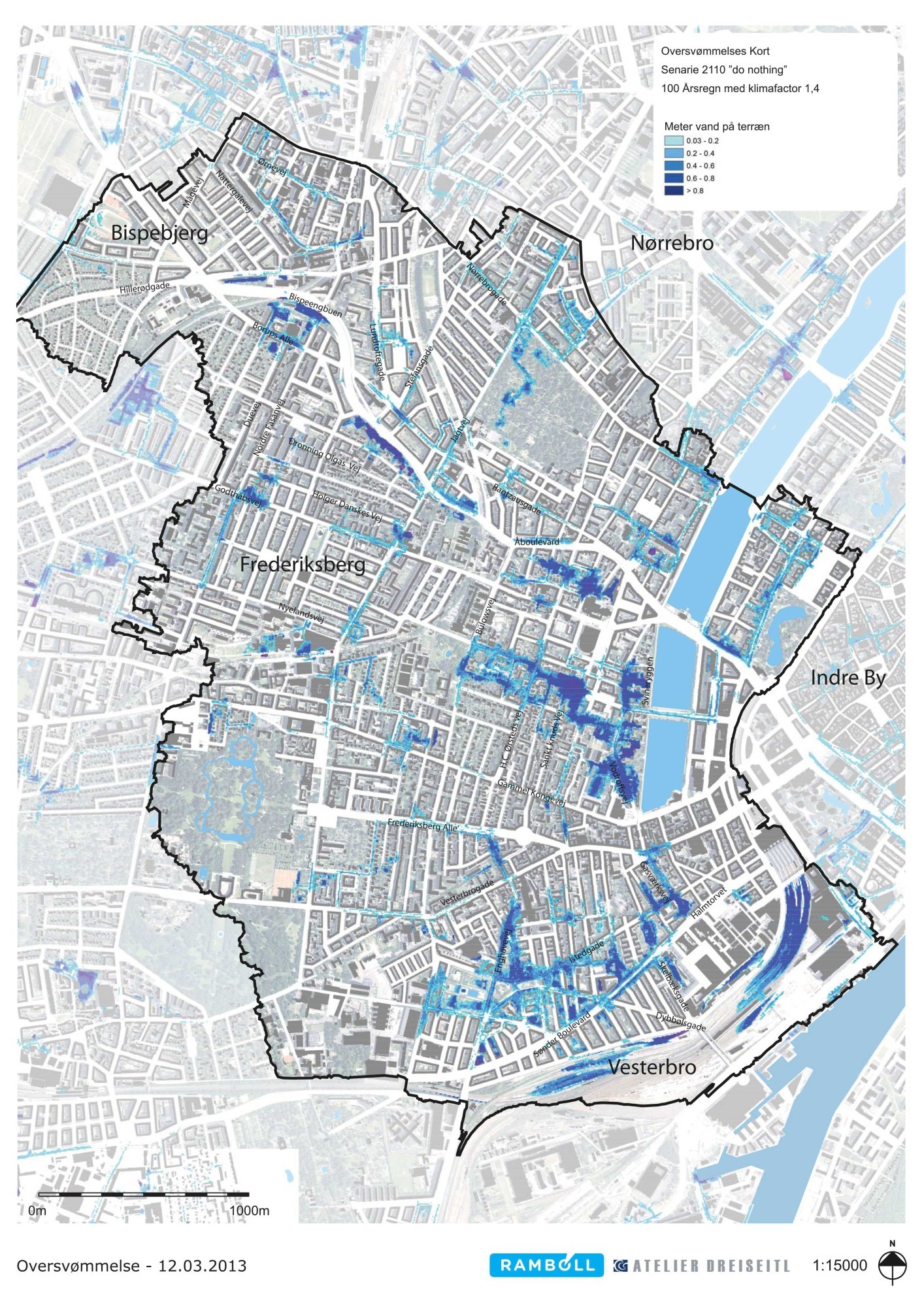
Quelle: Atelier Dreiseitl / Henning Larsen
Die Karte von Kopenhagen zeigt: Hätte man keine Umplanung des Wasserabflusses geplant, wären künftig grosse Teile der Stadt bei einem mittelgrossen Regenereignis unter Wasser gestanden: Das «Do nothing»-Szenario war Teil der Analyse von Ramboll-Atelier Dreiseitl nach dem Hochwasser 2011.
Ein anderes Beispiel für die Anwendung der Naturprinzipien
ist das Projekt «Cloudburst», dass wir für Kopenhagen geplant haben. Es zeigt,
wie sich eine Stadt für grosse Regenereignisse vorbereiten kann. 90 Prozent der
Regenereignisse sind zwar relative kleine Events. Doch in Kopenhagen erzeugte
ein Starkregen im Jahr 2011 grosse Probleme. Zu diesem Zeitpunkt wurde Wasser
durch Winde aus der Nordsee in die Häfen gedrückt. Damit war der Wasserstand
hoch, durch gleichzeitigen Starkregen wurden grosse Teile der Stadt überflutet.
Wir starteten mit der Idee, nicht so viel abfliessen zu
lassen. 30 Prozent des Regenwassers soll in den nächsten zwanzig Jahren vom
Abwasser abgekoppelt sein. Dafür gab es viele kleine Massnahmen – da ein
Gründach, dort eine Mulde, ein Regenrohr, das umgelenkt wird. Denn in einer
bestehenden Stadt dauern solche Massnahmen lange. Wegen dieses
Jahrhundertereignisses kam in der Stadt die Diskussion auf, wie die
Infrastruktur nachgebessert werden sollte. Vergräbt man nochmals unglaublich
viel Geld in Betonrohre im Untergrund? Oder investiert man in die Oberfläche,
überlegt sich, wie ist die vorhandene Topografie, wie kann man Strassen ändern,
wie kann das Wasser sicher durch die Stadt geleitet werden?
Heute gibt es Hauptkorridore für die Feuerwehr und
Rettungsfahrzeuge. Diese liegen höher und müssen sicher sein. Aber die
Strassen dazwischen, die kann man teilweise fluten und zu
Wolkenbruch-Korridoren umbauen. Das viele Geld, welches man in den Untergrund
vergraben müsste, konnte man in die Oberfläche investieren. Dadurch können zum
Beispiel mehr Bäume in der Stadt integriert werden.
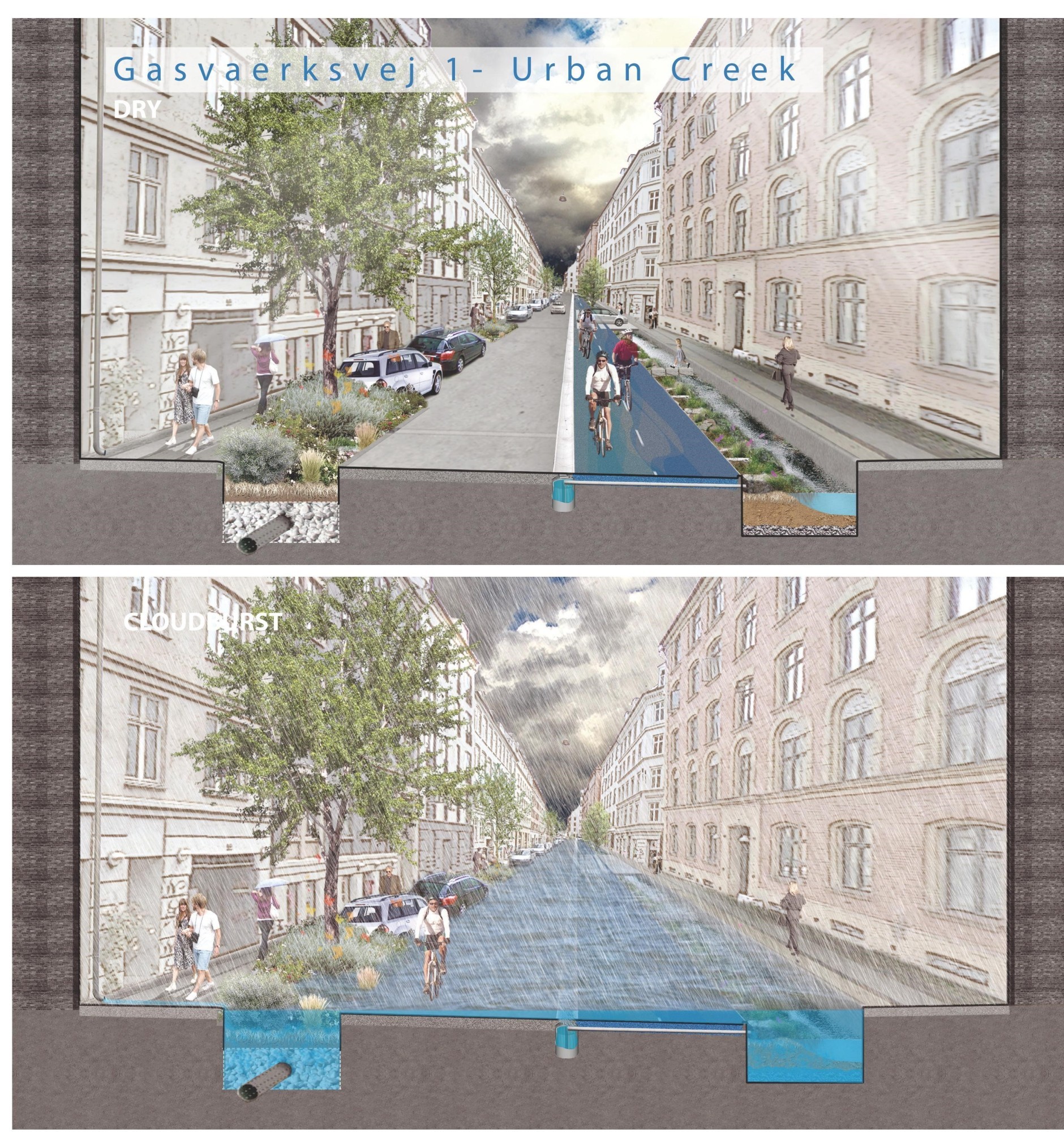
Quelle: Atelier Dreiseitl / Henning Larsen
Projekt «Cloudburst» in Kopenhagen: Die Umplanung weist Sicherheitszonen und Überflutungszonen im Strassenquerschnitt aus. Durch neue Pflanzkorridore bleiben die seitlichen Trottoirs auch bei starken Regengüssen begehbar.
Um Fakten zu haben, analysierten wir in Kopenhagen ein
Gebiet von 45 Hektar Innenstadt. Wir haben ein Regenereignis betrachtet, das
statistisch nur alle fünf Jahre auftritt, also ein mittelgrosses Regenereignis.
Im jetzigen Zustand fliessen zirka 17000 Liter pro Sekunde ab. Wenn dort alle
Dächer begrünt würden, könnte man den Regenfluss schon mal um 18 Prozent
reduzieren. Wenn noch Mulden gebaut worden und offenporige Strassenbeläge
verwendet, reduziert sich der Abfluss um 45 Prozent. Das ist schon richtig viel,
weil dadurch die Abflussrohre entlastet würden für Extremregenereignisse.
In Kopenhagen wird viel Wasser in Parkanlagen
zwischengespeichert. Wenn grosse Wassermengen zwei bis vier Stunden verzögert
abgeleitet werden, hilft das immens, um das unkontrollierte Fluten von Kellern
zu vermeiden. Die Sankt Jørgens Sø, die St. Jürgen Seen nahe der Innenstadt
sind dafür ein Beispiel.

Quelle: Silva Maier
Bepflanzungen im Stadtteil Greencity in Zürich: Zum Entwicklungskonzept des grünen Quartiers gehörte auch ein nachhaltiges Regenwassermanagement, dass dem Schwammstadt-Prinzip folgt.
Jetzt nach Zürich. Wie sieht Zürichs Untergrund aus? Wie
identifiziert man die Grünflächen in Zürich, in denen abgeleitet werden kann?
Wo spielt Wasser eine Rolle und welche Richtlinien müssen angedacht werden, um
das anzustossen?
Wir sind mitten in der Arbeit zur Strategie «Regenwasser im
Siedlungsraum» für Zürich. Als ersten Planungsschritt haben wir die naturnahe
Wasserbilanz für Zürich ermittelt. Wir sind davon ausgegangen, dass die Stadt
in ihrem Natur-, beziehungsweise Kulturzustand ein lockerer Mischwald wäre. Der
zweite Betrachtungsparameter ist das Gefälle, weil im steilen Gebiet viel mehr
abfliesst. Auch der Boden spielt bei der Versickerung eine grosse Rolle. Aus
diesen Parametern und lokalen Regendaten haben wir die naturnahe Wasserbilanz
errechnet. Unser Ergebnis sind vier Zonen mit unterschiedlichen Wasserbilanzen.
Danach haben wir die verschiedenen Stadtstrukturen und darin
liegende charakteristische Grundstücke untersucht. Ein typisches Grundstück
besteht aus versiegelten Flächen, Grünflächen und Gärten, sowie dem Gebäude
selbst. Sind die versiegelten Flächen und das Dach an die
Mischwasserkanalisation angehängt, fliesst oft über 50 Prozent des Regenwassers
ab. Werden die Dächer zur Hälfte begrünt, kann zum Beispiel die Verdunstung um
drei Prozent erhöht werden, bei eingeplanten Retentionsdächern sogar noch mehr.
Nimmt man an, die befestigten Flächen wären
wasserdurchlässig und das Dachwasser würde in einer Mulde versickern, kann der
Abfluss je nach Hanglage gegen 0 Prozent reduziert werden, Die Verdunstung kann
auf gut über 35 Prozent erhöht werden. Ganz simple Massnahmen können also das
Grundstück von 53 Prozent Wasserableitung auf 0 Prozent Wasserableitung
bringen. Das ist die Veränderung, die wir in Zürich über möglichst alle Flächen
erreichen wollen.
Welche Richtlinien schlagen Sie vor, um das heute
herrschende Arealdenken zu brechen? Was für Möglichkeiten bieten Richtlinien,
um bei Neubauten oder Umbauten einzugreifen? Was sind Ihre Erfahrungen?
Es gibt derzeit die kantonale Vorgabe, der besagt, dass
maximal 15 Prozent im Jahresdurchschnitt von einem Grundstück abfliessen darf.
Diese Vorgabe gilt für alle privaten Flächen. Für alle Flächen in Zürich, ob
privat oder öffentlich, also auch für Nachbarschafts- und Quartierstrassen,
haben wir jetzt strengere Richtwerte für den maximalen Abfluss definiert. Diese
Werte sind durch konsequent frühzeitige Berücksichtigung einer
Regenwasserplanung effizient und bezahlbar zu erreichen. Bauweisen und Planungsprozesse
sind bekannt, müssen nur neu oder besser integriert werden.
Wie ist ungefähr der Fahrplan gedacht für den
Regenwasserplan?
Der Fachplan Regenwasser im Siedlungsraum ist derzeit in
Erarbeitung. Da es eine stadtweite Vernehmlassung geben wird und der Stadtrat
letztendlich die Freigabe gibt, schätzen wir, dass er im Lauf des Jahres 2026
Verbindlichkeit erlangen könnte.
Gibt es Planungshilfen für die Anwendung und Umsetzung zum
Beispiel einen Katalog von Massnahmen, die helfen diese Zahlen zu erreichen?
Es wird verschiedene Hilfen geben, wir sprechen hier von der
Toolbox Fachplan RiS. Wir haben elf Handlungsansätze definiert, die nach
unserem Verständnis die wichtigsten Aspekte abdecken. z.B. das Grün auf einer
Parzelle an die tiefste Stelle zu planen, damit dort das Regenwasser versickern
kann und gleichzeitig der Bewässerung dient. Ein anderer Handlungsansatz weist
darauf hin, dass es oft hilfreich sein kann, das Regenwasser
parzellenübergreifend zu planen, dadurch findet man oft einfachere und kostengünstigere
Lösungen als auf einem begrenzten Einzelgrundstück.
In einem dichten Siedlungsraum sollte möglichst wenig
zusätzlicher Flächenverbrauch notwendig werden, sondern eher in kombinierten,
sich überlagernden Nutzungen gedacht werden. Die definierten Handlungsansätze
werden z.B. durch Best-Practice Beispiele veranschaulicht. Es wird auch eine
einfache Beschreibung geben, wie man eine solche Planungsaufgabe herangeht und
welche Informationen benötigt werden. Über das Züricher GIS-Portal werden
Richt- und Zielwerte, sowie Besonderheiten des jeweiligen Grundstücks parzellenscharf
zur Verfügung gestellt.
In all Ihrer Arbeit, was sehen Sie als Ihre Vision?
Meine Vision ist ein Integrieren von dynamischen
Naturprozessen in unserem unmittelbaren Lebensumfeld. Durch den Klimawandel
sind wir gezwungen uns damit auseinanderzusetzen und neue integrierte Lösungen
zu entwickeln. Dies ist ein erster Schritt hin zu einer sogenannten
«Bioregion». Das ist ein Konzept, bei dem die natürlichen Gegebenheiten und
Ressourcen einer über Naturgrenzen definierten Region bestimmen, wie wir
Menschen darin Leben, Arbeiten und Wirken können – nicht zerstörend, sondern
lebensfördernd. Das Wassersystem ist eine Möglichkeit auf dem Weg dahin
und kann beitragen, dieses Verständnis zu stärken.













