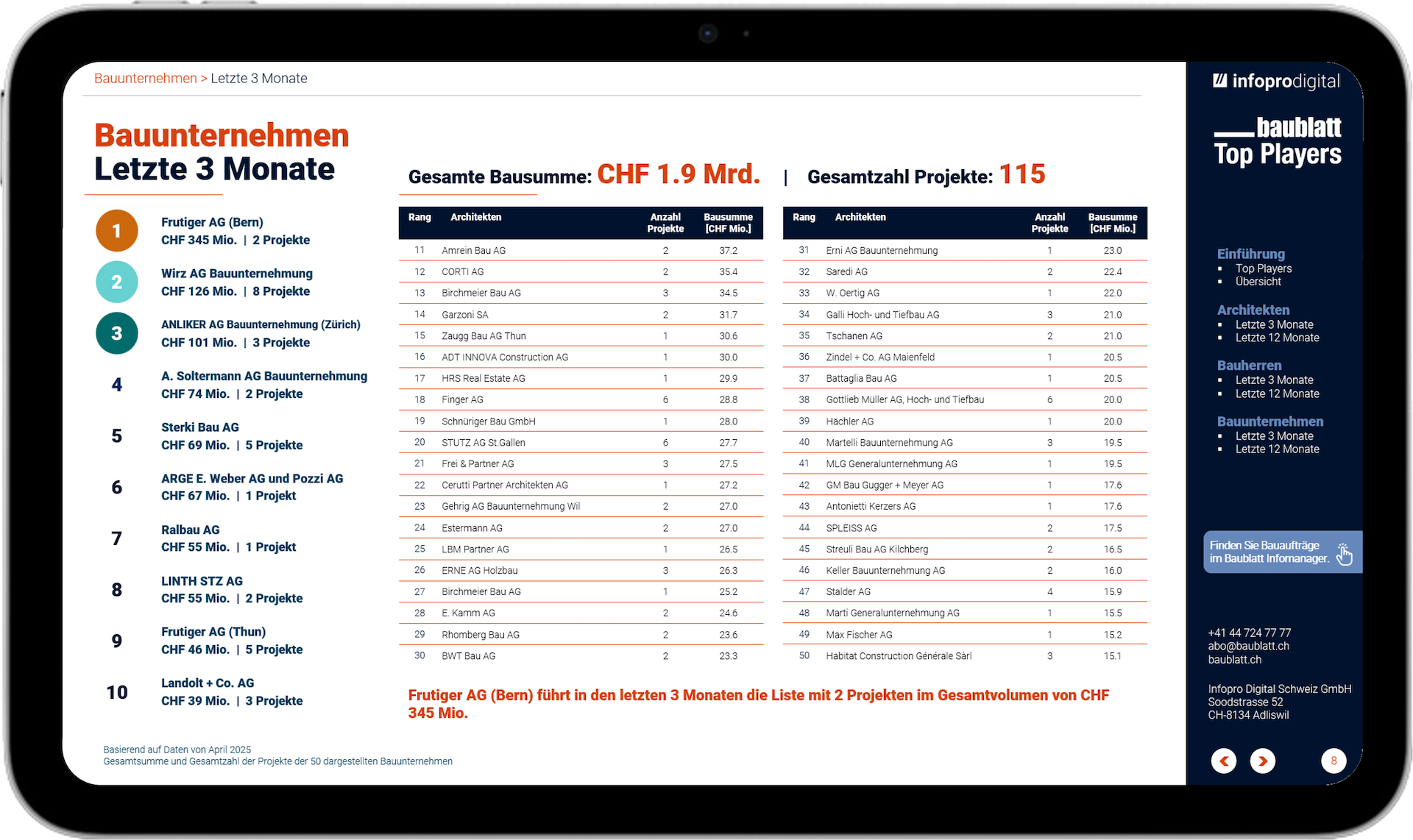Karin Bührer: «Wohnschutz: Der Netto-Null-Witz, der uns teuer zu stehen kommt»
In ihrer Kolumne beschäftigt sich Karin Bührer mit der Frage nach zunehmender Wohnregulierung und dem Dilemma zwischen guten Absichten und den daraus resultierenden, gegenteiligen Ergebnissen. Sie fordert ein Umdenken, um die Probleme in der Wohnpolitik ein für alle mal beheben zu können.

Quelle: zvg
Karin Bührer ist Geschäftsführerin bei Entwicklung Schweiz.
Wir sprechen oft über den akuten Wohnungsmangel und die steigenden Mieten in Schweizer Städten wie Zürich, Basel und Luzern. Angesichts dieser Knappheit treten politische Instrumente auf den Plan, die auf den ersten Blick verlockend klingen: der sogenannte Wohnschutz, meist verpackt als Mietpreisregulierung, Vorkaufsrechte für Gemeinden oder andere kreative Scheinlösungen. Man möchte damit bezahlbaren Wohnraum sichern und Mieter schützen.
Aber lassen Sie uns die Realität betrachten, gestützt auf harte Fakten, die eine aktuelle Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz am Beispiel Genf – einem Kanton mit strengem Wohnschutzregime – aufzeigt. Sie untersucht die Konsequenzen des Regimes und gelang zu dramatischen Ergebnissen: die Massnahmen der letzten Jahre gehen mit einem Rückgang der institutionellen Neubauinvestitionen von rund -400 Mio. CHF einher, so die Studie. Institutionelle und private Investoren zusammengerechnet beträgt der Rückgang der Bauinvestitionen rund -600 Mio. CHF auf Kantonsebene, was etwa 11 % der gesamten Bauausgaben entspricht.
Das ist ökonomisch relevant. Wir erleben eine politisch erzeugte Verknappung. Die Regulierung schützt den Bestand, zementiert aber gleichzeitig die Knappheit, da neue Einheiten kaum hinzu-kommen. Wer am dringendsten eine Wohnung sucht – oft junge Leute – zahlt am Ende drauf, weil die Knappheit die Preise am Markt nach oben treibt. Das ist der eigentliche Witz: Wohnschutz sorgt nicht für mehr günstigen Wohnraum, sondern für weniger Wohnraum insgesamt.
Nun zum Aspekt, der uns als Baufachleute besonders schmerzen muss und viel zu wenig Beachtung findet: die Sanierung.
Es ist zwar korrekt, dass die Regulatorien Kapital vom Neubau mehr in den Bestand verlagern, weil Investoren kurzfristig auf bestandserhaltende Renovationen ausweichen. Private Renovationsausgaben steigen kurzfristig nach einem Regulierungsschock deutlich an (etwa +200 Mio. CHF in den Jahren 1 - 3) gemäss der besagten Studie.
Aber Achtung: Bei diesen Massnahmen handelt es sich primär um schnell umsetzbare, «Behelfspakete» (z. B. Dämmung, Fenster, Heizungstausch). Es sind rudimentäre Verbesserungen, die das Objekt vermietbar halten, aber keine tiefgreifenden, kapitalintensiven Gesamtsanierungen wie sie für die Erreichung der Klimaziele notwendig wären.
Warum? Weil Mietpreisobergrenzen nach Sanierungen sowie Regulierungsvorgaben die Kostendeckung bei tiefgreifenden Erneuerungen unsicher machen. Strengere Obergrenzen auf die Mietanpassung nach den Arbeiten reduzieren den Anreiz für diese Arbeiten – sprich: es wird schlicht nicht mehr gemacht. Genf liefert den traurigen Beweis: 83,5 % der über 40 Jahre alten Wohnungen in Genf wurden nicht renoviert.
Wenn wir also Investitionen in tiefgreifende Erneuerungen abwürgen, werden wir das Ziel von Netto Null im Gebäudepark ganz sicher verfehlen. Der Wohnschutz erweist sich damit als Netto-Null-Witz: Er soll die Bevölkerung schützen, sabotiert aber gleichzeitig unsere Klimaziele, indem er die Sanierungsanreize zerstört.
Die Politik sollte deshalb Mieterschutz mit Angebots- und Qualitätszielen ausbalancieren. Statt Verbote und Mengenrestriktionen zu zementieren, brauchen wir planbare, regelkonforme Verdichtungs- und refinanzierbare Sanierungspfade.
Wir müssen positive Anreize setzen. Wenn ein Investor bereit ist, eine umfassende energetische Sanierung durchzuführen, sollte er dafür im Gegenzug mehr Ausnützung oder die Möglichkeit, höher zu bauen, erhalten.
Mit diesem Ansatz – Verdichtung PLUS Sanierung – lösen wir mehrere Probleme auf einmal: Wir erhöhen das Angebot an dringend benötigtem Wohnraum, wir schaffen die notwendigen Investitionsanreize für die Klimawende im Gebäudebestand, und wir fördern eine nachhaltige, marktwirtschaftliche Entwicklung. Es ist höchste Zeit, dass die Politik erkennt: Wer auf starre Regulierung setzt, bremst nicht nur den Neubau aus, sondern sorgt dafür, dass die «braven» Mieter zwar kurzfristig günstig wohnen, aber in schlecht unterhaltenen, klimapolitisch veralteten Gebäuden – während die Wohnungssuchenden verzweifelt bleiben. Drehen wir den Spiess um: Wir brauchen Freiheit und Anreize für das Bauen, nicht bürokratische Bremsklötze.
Die Studie finden Sie unter dem folgenden Link: www.diw.de