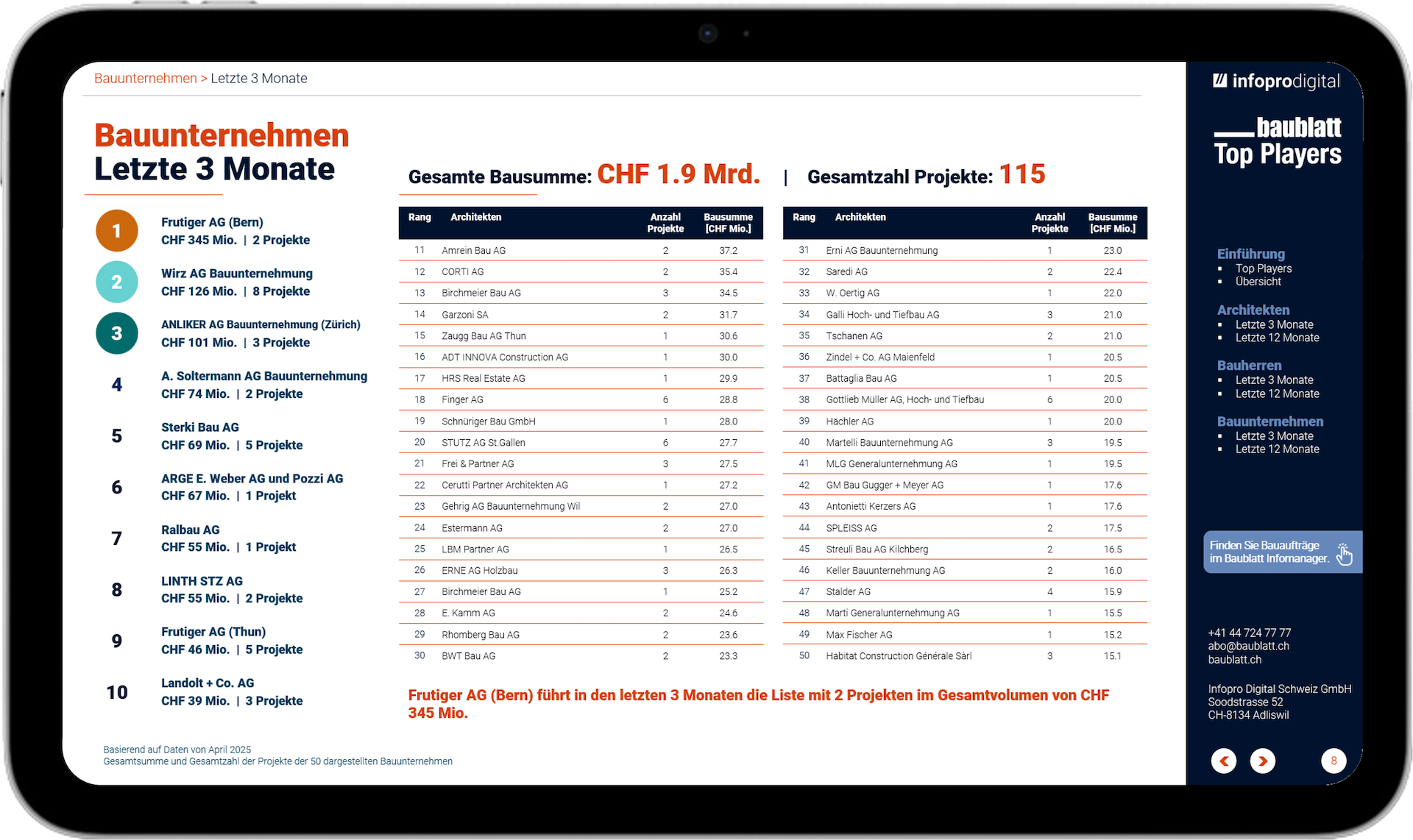«Die Politik muss entscheiden, ob es mehr Regulation braucht»
Staatsnahe Unternehmen konkurrenzieren zunehmend private KMU in freien Märkten – etwa im Schweizer Planermarkt. Ist dies gesellschaftlich gewünscht und wirtschaftlich sinnvoll? Ein Gespräch mit Reto Steiner, Direktor der School of Management and Law an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und Experte für öffentliches Management, über notwendige unternehmerische Spielräume, Wettbewerbsverzerrungen und regulatorische Leitplanken.

Quelle: Matthew Wilkinson (CC BY 2.0)
Foul oder Fairplay? Diese Frage stellt sich, wenn Staatsunternehmen private KMU konkurrenzieren.
Wie hat sich das Marktumfeld für Staatsunternehmen in den letzten Jahrzehnten verändert?
Reto Steiner: Ich würde von einer eigentlichen Neuregulierung sprechen, die in den 1990er-Jahren weltweit begonnen hat. Einerseits liess der Gesetzgeber nun in gewissen bis anhin staatlichen Bereichenbewusst Wettbewerb zu. Andererseits wurden dort Ausgliederungen aus den zentralen Verwaltungen vorgenommen, wo der Staat weiterhin als Produzent und Hersteller von Leistungen auftrat. Dazu zählen staatliche Aufgaben, die zwar im hoheitlichen Rahmen erbracht werden, bei denen aber dennoch eine Kunden- und Produzentensicht vorherrscht.
Aus organisatorischer Sicht entstanden neue Aktiengesellschaften und öffentlich-rechtliche Anstalten, die mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet, im Konkurrenzkampf mit den neuzugelassenen privaten Anbietern zu bestehen haben. Das war insbesondere bei Netzwerkindustrien der Fall, zu denen Eisenbahn, Post, Telekommunikation aber auch Energie zählen. Der Staat ist hier als Dienstleister oft auf Augenhöhe mit dem Konsumenten. Dieser kann entweder den Anbieter wählen oder sich in einer Monopolsituation zumindest als Kunde fühlen.
Wie haben die Schweizer Staatsunternehmen auf das kompetitivere Umfeld reagiert?
Die ausgegliederten Einheiten, die plötzlich im Wettbewerb standen, haben vermehrt begonnen, sich wie private Anbieter zu verhalten. Und das müssen sie auch. Denn der Staat fordert dort, wo er weiterhin Allein- oder Mehrheitseigentümer der neuaufgestellten Unternehmen ist, in der Regel eine marktübliche Rendite. Die Leistungen sollen allerdings gleichzeitig bürgerorientiert erbracht werden, also nach wie vor im Sinne eines «Service Public». Die Bevölkerung nimmt die ausgegliederten Einheiten nämlich weiterhin als staatliche Anbieter wahr, weshalb deren Leistungen überdurchschnittlich gut sein sollen.
Ein gutes Beispiel dafür sind die SBB. Diese gehören dem Staat und somit letztlich derBevölkerung. Deshalb haben wir alle die Erwartung, dass die Bundesbahnen uns mit ihren Leistungen dienen. Und obwohl die Politik von den SBB mehr Kosteneffizienz fordert, soll sich deren Angebot qualitativ weiter verbessern, dies im Quervergleich mit anderen nationalen und internationalen Mitbewerbern.
Akzeptieren Schweizer Steuerzahler unternehmerisch denkende, staatsnahe Betriebe also nur, wenn sie von diesen selbst profitieren?
Als indirekter Miteigentümer der Staatsunternehmen hat der hiesige Steuerzahler tatsächlich diesen Anspruch. Er ist ja gleichzeitig auch Konsument der Unternehmensleistungen und eine Art Schiedsrichter über einen fairen Wettbewerb mit gleich langen Spiessen. Für das Selbstverständnis des Bürgers ist es dabei unerheblich, dass die Eigentümerrolle letztlich von Regierungen wahrgenommen wird, die Schiedsrichterrolle ein Regulator innehat und die Bestellerrolle Fachdepartemente der Verwaltung gemeinsam mit der Politik ausüben.
Zur Person
Reto Steiner ist seit August 2017 Direktor der ZHAW School of Management and Law und Mitglied der ZHAW-Hochschulleitung (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften). Davor war er Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für öffentliches Management in Bern und amtete als Vizepräsident des Schulrats der Berner Fachhochschule. Einer der Forschungsschwerpunkte des einflussreichen Ökonomen und Experten für öffentliches Management sind teilautonome Organisationen und öffentliche Unternehmen.
Reto Steiner wurde 1971 in Olten geboren und schloss 1997 sein Studium in Wirtschaftswissenschaften und Recht sowie 2002 seine Promotion an der Universität Bern ab, wo er auch eine Professur innehatte.
Führen die unterschiedlichen Rollen des Staates nicht zwangsläufig zu Interessenskonflikten?
In verschiedene Rollen gleichzeitig zu schlüpfen, gelingt tatsächlich nie ganz widerspruchsfrei. Als Konsument einer Leistung wollen sie eine gute Qualität zu möglichst tiefen Kosten. Als Eigentümer liegt ihr Augenmerk jedoch auf einer guten Geschäftsführung und nachhaltigen Erträgen, die regelmässig reinvestiert werden können. Und das führt zu Konflikten. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat von Staatsunternehmen spüren heute zunehmend, dass sie gute Qualität zu günstigen Preisen liefern sollen – und dies bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines ausreichenden Gewinns. Denn nur ein solcher erlaubt es, zu reinvestieren, innovativ zu bleiben und dem staatlichen Eigentümer etwas für sein finanzielles Engagement zurückzugeben.
Das führt zu unternehmerischen Herausforderungen, deren Auswirkungen sich in den letzten Jahren vermehrt manifestieren. Sowohl die operative als auch die strategische Leitung von staatsnahen Unternehmen müssen mit den unterschiedlichen Erwartungen des Staates in seinen Rollen als Nutzer, Besteller, Finanzierer und Regulator der Leistungen umgehen können.
Wie verhält sich ein «staatsnaher Unternehmer» denn sinnvoll?
Dieser muss sich gut überlegen, was er macht. Unternehmer sind ja primär dafür da, unternehmerisch zu handeln und die Ansprüche des Eigentümers zu erfüllen. Auch für ein staatliches Unternehmen ist es rational, die Kosten tief zu halten und die Erträge zu maximieren. Das geht am einfachsten via Wachstum und genutzte Skaleneffekte. Die Frage ist deshalb, wie ein Staatsunternehmen seinen Umsatz steigern kann. Neue Kunden mittels Produktinnovation und -diversifikation zu gewinnen, ist eine Strategie. Sich als staatsnahes Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Mitbewerbern zurückzuhalten – selbstverständlich im regulatorisch zulässigen Ausmass – ist eine andere Option. Am schnellsten ausbauen lässt sich jedoch der eigene Marktanteil, indem man private Mitbewerber aufkauft.
Wann soll ein staatliches Unternehmen mittels Akquisitionen in freie Märkte vordringen können?
Bei der Marktwirtschaft, wie wir sie in der Schweiz kennen, liegt das Primat grundsätzlich immer bei der Privatwirtschaft. Dem Staat kommt nur eine subsidiäre Funktion zu, nämlich dort aufzutreten, wo er ein Marktversagen ortet. Fehlt ein solches, stellt sich schon die Frage, ob ein staatsnahes Unternehmen intervenieren, Mitbewerber aufkaufen und somit die Privatwirtschaft direkt konkurrenzieren darf. Denn was erlaubt ist und was nicht, ist in solchen Fällen nicht klar geregelt.
Kann dies der Gesetzgeber überhaupt abschliessend klären?
Was der Staat soll und was nicht, ist eine ordnungspolitische Frage. Die Politik kann auf Gesetzesebene insbesondere festlegen, wo es überhaupt staatliche Unternehmen geben soll und welche Aufgaben diese zu erfüllen haben. Doch die statische Gesetzgebung regelt dies lediglich im Grundsatz. Es bleibt also zwangsläufig ein gewisser Interpretationsspielraum übrig.
Wenn aber staatliche Mittel in spezifische Aufgabenbereiche mit Grundversorgungsauftrag fliessen, ist es dem staatlichen Unternehmen untersagt, mit diesen Mitteln in anderen Aufgabenbereichen Private zu konkurrenzieren. Ich denke hier beispielsweise an den jüngsten Postautoskandal. Das Management der Post hatte Mittel, die aus der staatlichen Abgeltung des Grundversorgungsauftrags stammten, dafür eingesetzt, um in anderen kompetitiven Marktbereichen bestehen zu können. Eine solche Quersubventionierung ist nicht erlaubt.
Schwieriger ist die Beurteilung, wenn staatsnahe Unternehmen in freien Märkten als Konkurrenten von Privatanbietern auftreten oder gar Mitbewerber übernehmen. Da der Gesetzgeber von Staatsunternehmen unternehmerisches Denken und Handeln fordert, können Übernahmen zur Diversifizierung des Produkte- und Dienstleistungsangebots durchaus rational und angezeigt sein. Solche Akquisitionen sind nicht verboten. Ob sie letztlich gewollt sind, muss der Gesetzgeber klären. Derzeit sind hier meines Erachtens gewisse Unsicherheiten vorhanden. Obwohl ich nicht denke, dass man diese komplett ausräumen kann, muss die politische Debatte hierzu geführt werden. Es gilt zu beantworten, in welchem Ausmass ein staatliches Unternehmen seine privaten Mitbewerber konkurrenzieren darf.
Wie kann die Politik im Einzelfall intervenieren, wenn sie einen Missbrauch ortet?
Die Politik hat verschiedene Möglichkeiten, wie sie vorgehen kann. Sie kann Staatsunternehmen eine Tätigkeit in Märkten mit funktionierendem freien Wettbewerb untersagen. Bei einem bereits bestehenden Engagement, das zu ungewollten Wettbewerbsverzerrungen führt, kann der Staat via Gesetz oder durch seine Vertreter in den Aufsichtsgremien aber auch durch die Vorgabe von Eignerzielen das Staatsunternehmen zum Rückzug verpflichten respektive den Verkauf des entsprechenden Unternehmensteils und dessen materielle Privatisierung verlangen.
Denkbar ist es natürlich auch, ein Staatsunternehmen integral materiell zu privatisieren. Lassen sie mich ein hypothetisches Beispiel für die Schweiz machen: Bei der Swisscom, die eigentlich ausschliesslich in wettbewerbsintensiven Märkten tätig ist, könnte sich der Staat komplett aus dem Unternehmen zurückziehen. Als materiell privatisiertes Unternehmen hätte die Swisscom anschliessend keinerlei Einschränkungen durch den Staat mehr, ausser solchen, die auch die privaten Telekommunikationsunternehmen betreffen.
Eine solche Privatisierung eines staatsnahen Unternehmens wäre aber ein radikaler Lösungsansatz. Zu radikal für die Schweiz?
Höchstwahrscheinlich ja. Sowohl die Schweizer Bevölkerung als auch die hiesige Politik anerkennen durchaus die guten Leistungen, welche staatliche Unternehmen erbringen. Gerade bei Dienstleistern mit einem Grundversorgungsauftrag wird die indirekte politische Kontrolle als vorteilhaft eingeschätzt.
Diesen Eindruck bestätigt beispielsweise auch das kürzlich verabschiedete neue Beteiligungsgesetz des Berner Energieversorgers BKW. Die Politik schreibt darin den Kanton Bern als staatlichen Mehrheitseigner vor und will damit unter anderem sicherstellen, dass systemrelevante Infrastrukturen in inländischer Hand bleiben. Meiner Meinung nach sind derzeit in der Schweiz keine politischen Mehrheiten für die materielle Privatisierung von staatsnahen Unternehmen vorhanden – und dies selbst bei funktionierendem Wettbewerb.
Wären hierzulande allenfalls Teilprivatisierungen denkbar?
Diejenigen Bereiche eines Staatsunternehmens, die im intensiven Wettbewerb stehen, könnten tatsächlich von denjenigen mit einem Grundversorgungsauftrag entflochten werden. Materiell privatisiert würden in diesem Fall nur die Unternehmensbereiche im kompetitiven Marktumfeld. Die anderen Geschäftsfelder würden unter staatlicher Kontrolle verbleiben. Eine solche Teilprivatisierung ist aber nur dann eine reelle Option, wenn dadurch nicht wertvolle Synergien verloren gehen. Würde etwa lediglich die Schieneninfrastruktur beim Staat verbleiben, Personen- und Güterverkehr jedoch privatisiert, könnten daraus wegen der engen Verknüpfung der Teilbereiche sogar betriebliche Probleme erwachsen. Die wahrscheinlichste Folge: Die Qualität der Bahnleistungen würde unter der Aufspaltung leiden.
Ich denke, die Teilprivatisierung kommt nur für Bereiche infrage, bei denen staatliche Leistungen plötzlich in vollem Wettbewerb erbracht werden, und wo die Synergien gering sind. Ein Beispiel wären neue Postauto-Dienstleistungen, die im Ausland angeboten würden und nicht zu den Kernaufgaben des Staatsunternehmens gehören.
Gibt es noch andere politische Interventionsmöglichkeiten?
Der Staat kann Staatsunternehmen auch unverändert belassen, ihnen aber untersagen, gewisse Aufgaben wahrzunehmen. Einem Energieunternehmen könnte etwa verboten werden, private Ingenieurunternehmungen aufzukaufen, weil dort ein funktionierender Markt besteht. Eine solche strategische Einschränkung müsste die Politik in der Eignerstrategie verankern. Sie definiert mit diesem dynamischen Steuerungsinstrument Ziele für das Unternehmen, etwa bezüglich Finanzen und Aufgabenerfüllung.
Angesichts der Tatsache, dass bei Energieunternehmen die Erträge im Grundversorgungsbereich aufgrund der aktuellen Marktlage einbrechen, lässt sich die Erschliessung neuer Ertragsquellen politisch aber kaum untersagen. Das Management staatsnaher Unternehmen braucht strategische Optionen, um die gesteckten Ertrags- und Umsatzziele zu erreichen. Ich kann aber ebenso gut verstehen, dass man in Märkten mit funktionierendem Wettbewerb staatliche Übernahmen von Mitbewerbern aus ordnungspolitischen Gründen kritisiert.
Die Politik kann zudem staatsnahen Unternehmen Regeln vorgeben, wie diese tätig sein müssen. Das ist aber oft einfacher gesagt als getan. Ich denke hier etwa an die kantonalen Gebäudeversicherungen, die in Bereiche mit privater Konkurrenz vorgedrungen sind. Die kantonalen Gesetzgeber schrieben für diese Engagements die Gründung von Tochtergesellschaften vor, die vom Kerngeschäft unabhängig sind. Die Absicht war dabei, den Aufbau der neuen Geschäftsbereiche über die Monopolrente zu verunmöglichen. Dabei gingen jedoch die immateriellen Werte vergessen wie insbesondere die umfassenden Kundendaten. Schliesslich sind in denjenigen Kantonen mit einem Gebäudeversicherungsmonopol alle Hauseigentümer ohne Ausnahme bei der gleichen Anstalt zwangsversichert.
Die Frage ist also tatsächlich, was man verbietet und reguliert. Dabei kann es schnell sehr filigran werden.
Braucht es denn einfach mehr Transparenz?
Staatsunternehmen müssen heute transparent sein. Schliesslich geben die Regierungen entsprechende Ziele vor und wollen als Aufsichtsorgan über die Resultate informiert sein. Die Parlamente aller Staatsebenen nehmen ihrerseits die Oberaufsicht wahr und schauen, wie die Regierungen ihre Arbeit erledigen. Meines Erachtens funktioniert das in den Kantonen und Städten professionell. Die Herausforderung liegt vielmehr darin, festzulegen welche Informationen die staatsnahen Unternehmen genau liefern und diese nach Erhalt korrekt zu interpretieren.
Das ist bei staatlichen Grossunternehmen gar nicht so einfach. Gerade im Energie- und Transportbereich, aber auch in anderen Netzwerkindustrien braucht es ein fundiertes Fachwissen, um die unternehmerische Tätigkeit zu verstehen und diese auch beaufsichtigen zu können. Nach der Ausgliederung der Staatsunternehmen musste dieses Wissen in der Verwaltung, welche die Eignerinteressen wahrnimmt, zuerst wieder aufgebaut werden.
Können Kampagnen, die auf die Problematik der staatlichen Konkurrenz hinweisen – wie etwa «Fair ist anders» des Gewerbeverbands Berner KMU – etwas an der vorherrschenden Situation ändern?
Ich denke schon. Jedenfalls finde ich es gut, dass der Berner Gewerbeverband in seiner Kampagne die Thematik aufnimmt. Denn tatsächlich hat der Berner Energieversorger BKW in jüngster Zeit private Ingenieurunternehmen in grösserer Zahl aufgekauft. Die Antwort, ob dies so wünschenswert ist, kann ich als Wissenschafter nicht geben. Das ist letztlich ein politischer Entscheid.
Wichtig ist, dass der Umstand bekannt ist. Die Politik muss in Kenntnis der Tatsachen entscheiden, ob es mehr Regulation braucht und wie genau staatsnahe Unternehmen gesteuert werden sollen. Im Kanton Bern wollte eine klare politische Mehrheit die BKW staatlich belassen. Die politische Linke befürwortete dies, weil sie der Ansicht ist, dass Staatsunternehmen bessere und gerechtere Leistungen erbringen als Privatunternehmen. Die politische Rechte wollte hingegen weiterhin als staatlicher Eigner Einfluss nehmen und so verhindern, dass sich plötzlich ausländische Unternehmen am Grundversorger BKW beteiligen. Eine Koalition aus Links und Rechts hat somit indirekt beschlossen, dem Berner Energieversorger Freiräume zu lassen, um unternehmerisch tätig zu sein. Deshalb ist die BKW rechtlich korrekt unterwegs. Politisch ist derzeit zudem kein Wille erkennbar, am Status Quo etwas zu ändern. Es ist deshalb sinnvoll, wenn der Berner Gewerbeverband auf eine gute Art und Weise für seine Anliegen sensibilisiert. Schliesslich stellt sich schon die Frage, ob es eine staatliche Aufgabe ist, private Mitbewerber in einem voll funktionierenden Markt aufzukaufen.
Als Direktor der ZHAW School of Management and Law sind Sie selbst für eine öffentlich-rechtliche Anstalt in leitender Funktion tätig. Wie meistern Sie dabei die unternehmerische Gratwanderung?
Persönlich bin ich der Meinung, dass auch staatliche Unternehmen möglichst viel Freiraum in ihrer Arbeit brauchen, um unternehmerisch agieren zu können. Die Spiesse von staatlichen und privaten Marktteilnehmern müssen dabei aber immer gleich lang, der Wettbewerb fair und transparent sein. Dort wo staatliche Steuermittel fliessen, dürfen daraus keine privaten Aktivitäten finanziert werden. Hochschulen wie wir haben genau diese Auflage.
Als Direktor einer der grossen Business-Schulen der Schweiz bekomme ich Gelder für unseren Lehrauftrag, der die vom Staat gewollte qualitativ hochstehende Ausbildung der Studierenden umfasst. Zudem erhalte ich eine Teilfinanzierung für unsere Forschungsaktivitäten, weil der Staat der Meinung ist, dass Private die gesellschaftlich wichtige Forschung nicht vollständig finanzieren würden. Mir ist es jedoch untersagt, aus diesen staatlichen Mitteln Weiterbildungs und Beratungsangebote zu finanzieren, für die es einen funktionierenden Markt gibt.
Es ist politisch gewollt, dass wir unser Leistungsangebot marktgerecht ausbauen. Im kompetitiven Umfeld müssen wir uns damit aber wie jeder andere private Anbieter bewähren. Ich finde, das ist eine gute Regelung.
Nachgefragt … bei Bernhard Berger
Warum ist es aus der Sicht Ihrer Mitglieder stossend, wenn staatsnahe Unternehmen sich neue Geschäftsfelder im freien Markt erschliessen?
Bernhard Berger: Das erste Problem ist die Vermischung von privaten und öffentlichen Aufgaben: Wer oder was stellt sicher, dass vom subventionierten Bereich direkt oder indirekt keine Ressourcen in den privaten Bereich fliessen? Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch etwa um Wissen, Daten und Werbemassnahmen. Dies führt zu ungleich langen Spiessen zwischen privaten und öffentlichen Anbietern.
Das zweite Problem ist ein ordnungspolitisches: Nach unserem liberalen Verständnis soll der Staat nur diejenigen Aufgaben übernehmen, die nicht durch den freien Markt effizienter erbracht werden können. Wenn es dann aber doch so sein soll, braucht es klare Strukturen sowie eine vollumfängliche Transparenz, um mögliches Fehlverhalten nachvollziehen zu können.
Welche Wettbewerbsverzerrungen durch Monopolisten beobachten Sie aktuell im Schweizer Planermarkt?
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil seitens der entsprechenden Akteure die Transparenz fehlt. Sorgen bereiten uns einzelne staatlich dominierte Energiedienstleister, die mit ihrem im Monopolbereich aufgebauten Kapital im grossen Stil Ingenieurbüros aufkaufen. Da diese Konzerne häufig auch grosse Auftraggeber sind, kann dies zu heiklen Interessenkonflikten führen oder gar verhindern, dass Aufträge an den freien Markt kommen. Zudem könnten Kundendaten aus dem Monopolbereich für die Akquisition verwendet werden. Besonders stossend wird es, wenn diese Abhängigkeiten für den Kunden kaum erkennbar sind.
Was fordert die Usic, um den fairen Wettbewerb im Markt Ihrer Mitglieder wiederherzustellen?
Die Usic ist entschieden dagegen, dass Unternehmen mit einem staatlichen Versorgungsauftrag ihre Monopolstellung dazu verwenden, um sich in Märkten des freien Wettbewerbs ungerechtfertigte Vorteile gegenüber anderen Mitbewerbern zu verschaffen. Dies heisst konkret: Vollständige Trennung von Kosten und Gewinn zwischen Monopol- und Wettbewerbsbereich, Vollständige wirtschaftliche und operative Unabhängigkeit zwischen Monopol- und Wettbewerbsbereich und keine Übertragung der Vorteile aus dem Monopolbereich in den Wettbewerbsbereich sowie eine Aufsicht.
Wie können Sie Politik und Verwaltung für diese Anliegen gewinnen?
Steter Tropfen höhlt den Stein: Wir führen schon seit einiger Zeit Diskussionen innerhalb des Verbandes, mit den Medien, mit Verwaltungsmitgliedern, mit Politikern sowie mit Vertretern anderer Verbände. Die jüngsten Skandale haben nun aber die Debatte beschleunigt, weshalb wir im Herbst einen Sessionsanlass für Bundesparlamentarier zu diesem Thema durchführen. Dafür konnten wir Nationalrat Peter Schilliger, den Zürcher Stadtrat Michael Baumer sowie Professor Johannes Reich von der Universität Zürich gewinnen.