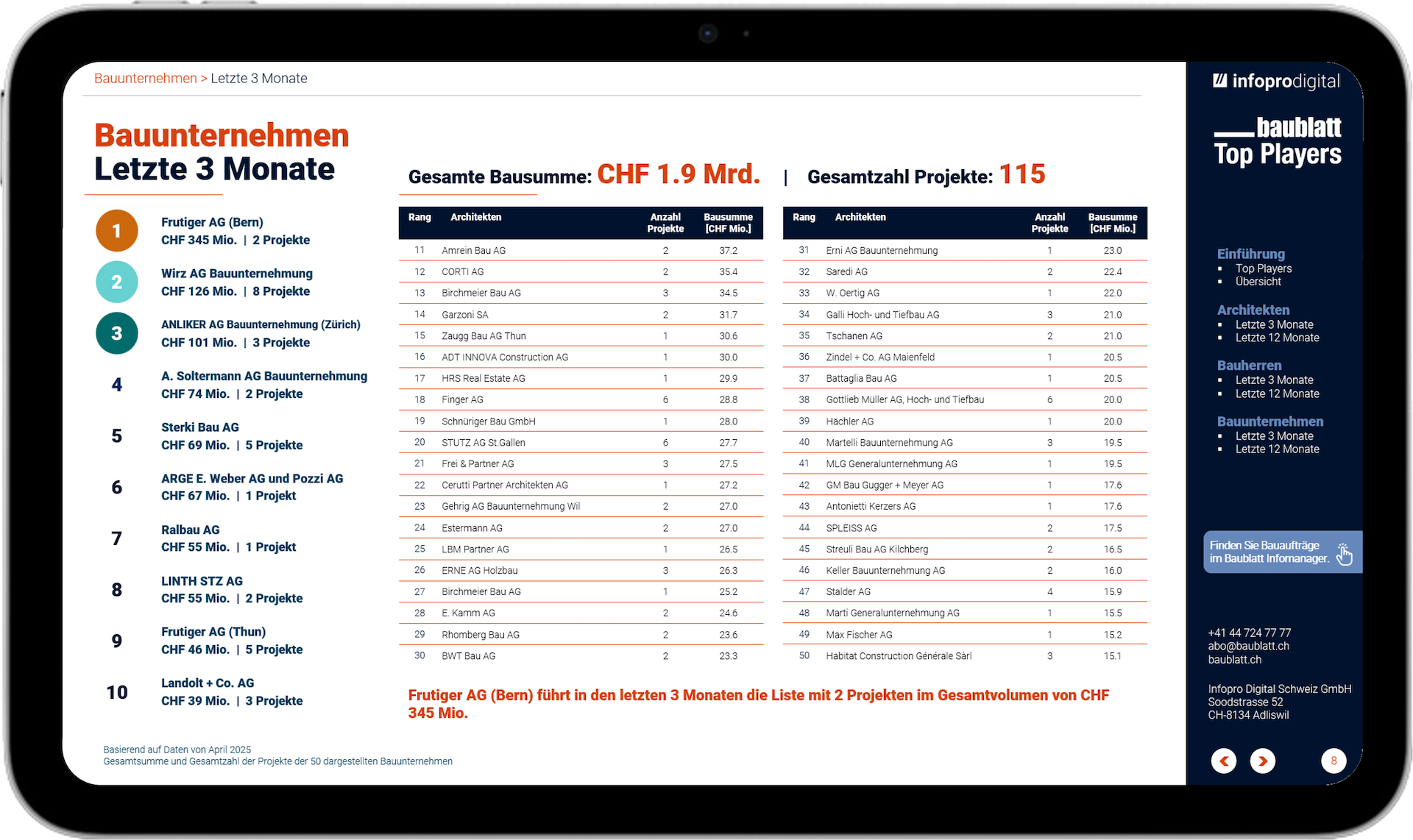Methanol: Die flüssige Sonne im Tank im Praxistest
Eine rundum mit Photovoltaik-Modulen verkleidete Wohnüberbauung produziert überschüssigen Sommerstrom, der sich in die leicht lagerbare Flüssigkeit Methanol umwandeln lässt. Diese «flüssige Sonne» wiederum versorgt die Überbauung im Winter mittels Hybridbox mit Energie. Diese vielversprechende Anwendung der Power-to-X-Technologie wird in einem Leuchtturm-Projekt in Bassersdorf ZH umgesetzt.

Quelle: Stiftung Umwelt-Arena Schweiz
Diese Wohnüberbauung im zürcherischen Bassersdorf geht bei der Power-to-X-Technologie neue Wege und setzt auf Methanol als Energieträger.
Die Energiewende ist in vollem Gang. An der nachhaltig produzierten Elektrizität als Energieträger führt kein Weg vorbei, wobei hierzulande vor allem die Photovoltaik (PV) ein grosses Zuwachspotenzial besitzt. Sowohl in Sachen Mobilität als auch im Gebäudesektor verdrängen elektrische Lösungen die bisherigen Motoren und Heizungen, die noch mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Doch diese Elektrifizierung erhöht, trotz Effizienzsteigerung in allen Bereichen, den Strombedarf weiter. Eine weitere Herausforderung: Solarstrom hat den bekannten Nachteil, dass die Produktion saisonal stark schwankt. In diesem Zusammenhang warnen Expertinnen und Experten vor einer drohenden Winterstrom-Lücke. Anders ausgedrückt erwächst so die Aufgabenstellung, den im Sommer im Überschuss vorhandenen PV-Strom für den sonnenärmeren Winter zu speichern.
Eine Art indirekten Speicher stellen Power-to-X-Verfahren dar: Sie verwenden den im Sommer überschüssigen Strom, um daraus einen anderen Energieträger zu gewinnen, der sich besser, sprich ohne grosse Verluste, bewahren und bei Bedarf wieder in Strom umwandeln lässt.
Kniffliger Wasserstoff
Oft genannt wird dabei Wasserstoff, der in grossen Mengen auf der Erde vorkommt. Doch seine Speicherung ist knifflig: Bei Raumtemperatur ist das Element gasförmig und hat eine geringe Energiedichte. Um das Gas zu verflüssigen und somit speicherbar zu machen, muss es auf extreme 243 Grad Celsius unter Null abgekühlt werden, was energieintensiv und kostspielig ist. Ein zweiter Weg zur Verflüssigung ist eine Komprimierung unter sehr hohem Druck. In beiden Fällen bleibt das Problem, dass Wasserstoff Materialien spröde macht: Bei Tanks entsteht entsprechend die Gefahr von Leckagen.

Quelle: Stiftung Umwelt-Arena Schweiz
Die Wohngebäude der Überbauung sind mit einem Dach und einer Fassade aus Photovoltaik-Modulen eingekleidet.
«Wasserstoff ist mühsam im Handling», bestätigt Boris Meier, Energieexperte an der Fachhochschule Ost in Rapperswil. Meier ist Fachbereichsleiter Power-to-X-Einführung am Institut für Energietechnik. Zusammen mit der Umwelt-Arena Spreitenbach hat der Wissenschaftler ein Pilotprojekt entwickelt, das auf ein anderes Speichermedium setzt: Methanol (siehe Box «Zwischenstation Wasserstoff»).
Problemloses Methanol
«Methanol, also der einwertige Alkohol, ist bei Raumtemperatur flüssig, deshalb einfach zu handeln und zu lagern, und dazu noch vergleichsweise Platz sparend», erklärt Meier an einem Medienevent. In der Schweiz benötigt und importiert bislang in erster Linie die chemische Industrie das Methanol. Wobei der Stoff meist aus Erdgas oder Kohle gewonnen wird, mit entsprechend schlechter Umweltbilanz.

Quelle: Stiftung Umwelt-Arena Schweiz
Dank Photovoltaik und energieeffizienter Bauweise lassen sich die Gebäude im Sommer komplett mit Sonnenstrom betreiben.
Wird Methanol jedoch mittels erneuerbaren Energien erzeugt, lässt es sich anschliessend mit neutraler CO₂-Bilanz thermisch verwerten. Boris Meier sieht im einwertigen Alkohol deshalb ein Schlüsselelement für die nachhaltige Energieversorgung. «Nach unseren Berechnungen reichen etwa 150 grosse Methanoltanks aus, um die Winterstromlücke der gesamten Schweiz zu decken.» Diese Tanks würden dafür eine Fläche von etwa einem Quadratkilometer einnehmen und die fehlenden neun Terawattstunden bereitstellen.
Im Keller steht eine Hybridbox
Ein aktuelles Methanol-Projekt soll hierbei als Pilot dienen: Der Brennstoff versorgt eine neu erstellte Wohnüberbauung an der Bahnhofstrasse 12 in Bassersdorf ZH mit der zum Heizen und Kühlen benötigten Energie. Das Wohnhaus ist auf dem Dach wie auch an den Fassaden mit Photovoltaik-Modulen bestückt. Im Keller steht eine Hybridbox, die auf den Betrieb mit Methanol umgerüstet wurde. «Die Hybridbox kombiniert zwei Technologien: ein Blockheizkraftwerk und eine Wärmepumpe. So produziert sie Wärme, Kälte und Strom, und das extrem effizient», betont Walter Schmid, der Gründer der Umwelt Arena Schweiz. Die Stiftung mit Sitz im aargauischen Spreitenbach realisiert das Projekt zusammen mit der Hochschule Rapperswil und der Pro-Energie, Projekt- und Energiemanagement GmbH aus Sirnach TG realisiert. Das Projekt ist zudem Teil von «Greenhub», einem vom Bund unterstützten und von diversen Hochschulen und Industriepartnern getragenen «Flagship»-Programms. Greenhub hat sich zum Ziel gesetzt, ökologische, wirtschaftliche und sozial tragfähige, skalierbare Lösungen zu entwickeln.

Quelle: Stiftung Umwelt-Arena Schweiz
Zentraler Baustein der Energieversorgung: Im Heizungskeller steht eine Hybrid-Box, die für den Betrieb mit Methanol umgerüstet wurde.
Beim Bau der Häuser in Bassersdorf wurde in mehreren Komponenten auf Energieeffizienz geachtet. Das Minergie-Haus verfügt über eine Lüftung sowie Duschen mit Wärmerückgewinnung. Ausserdem sorgen eine optimierte Isolation, sparsame Haushaltsgeräte sowie eine Bodenheizung, die mit niedrigen Temperaturen funktioniert, für einen niedrigen Verbrauch. Darüber hinaus werden die Bewohnerinnen und Bewohner in die Pflicht genommen: Die stetige Anzeige ihres Energieverbrauchs soll sie zu einem bewussten Verhalten motivieren. Ausserdem haben sie ein Energiebudget zur Verfügung: Bis zu einer gewissen Limite ist der Strom im Mietpreis inbegriffen. Wer mehr verbraucht, muss draufzahlen.
Zielwirkungsgrad 60 bis 70 Prozent
Dank der energieeffizienten Bauweise lassen sich die Gebäude im Sommer komplett mit Sonnenstrom betreiben. Und mit dem überschüssigen Strom wird Methanol für den nächsten Winter produziert. In der kalten Jahreszeit, wenn der Ertrag aus der Photovoltaik nicht für den Betrieb ausreicht, wird das Methanol in einem Blockheizkraftwerk in Strom umgewandelt. Als Nebenprodukt entsteht Abwärme, die wiederum die Wärmepumpe weiterverarbeiten kann. «So lässt sich ein Gebäude im Winter lange mit Methanol betreiben, da der Verbrauch generell tief ist», erklärt Energieexperte Roger Balmer. Als Inhaber der Pro-Energie GmbH begleitet er die Umsetzung des Methanol-Projekts in Bassersdorf. Der Zielwirkungsgrad der Anlage liegt bei 60 bis 70 Prozent. Damit werde die Überbauung einen Bedarf von jährlich nur rund 2000 Litern Methanol haben, rechnet Balmer vor.
Zurzeit wird das Methanol für die Bassersdorfer Häuser noch aus dem Ausland importiert. Doch der zweite zentrale Teil des Projekts ist die Herstellung in der Schweiz: Vor kurzem begannen die Arbeiten in der Kehrrichtverbrennungsanlage Horgen, die bis 2026 die erste Schweizer Methanol-Anlage erhält. Ab dann soll der überschüssige Sonnenstrom aus Bassersdorf, der ins Stromnetz eingespeist wird, in lagerbare Energieträger umgewandelt werden
Verbesserte Rahmenbedingungen
Das Bassersdorfer Pionier-Projekt mit dem neuen Energieträger hatte nicht nur technische, sondern auch behördliche Hindernisse zu überwunden: Methanol durfte bis anhin nur in Tanks von maximal 2000 Litern Fassungsvermögen gelagert werden. Für grössere Wohnüberbauungen wäre dies aber deutlich zu wenig. In Zusammenarbeit mit den Behörden konnten die Verantwortlichen jedoch die Bedenken bezüglich der neuen Technologie überwinden: Nun sind Tanks bis 20’000 Liter erlaubt. Auch Player wie die Feuerwehr und Gebäudeversicherung galt es zu überzeugen, weshalb alleine das Bewilligungsverfahren zwei Jahre dauerte.
Die Investitionskosten für die Methanol-Heizung fallen höher aus als bei herkömmlichen Lösungen. Das bestätigt Pro-Energie-Projektleiter Roger Balmer. «Ob es sich langfristig finanziell auszahlt, hängt stark von der Entwicklung des Strompreises ab», sagt er. Die weitgehende Eigenversorgung habe aber den Vorteil, dass man nur noch minimal externe Energieträger benötige: «Dies sorgt für planbare und tiefe Betriebskosten über viele Jahre.» Steigt in Zukunft die Lenkungsabgabe auf Kohlendioxyd, wird das Sparpotenzial dieser sich selbst versorgenden Überbauung im Vergleich zu Anlagen mit fossilen Brennstoffen gar noch grösser. (bk)
Zwischenstation Wasserstoff

Quelle: Forum Zürcher Abfallverwertung (ZAV) / Fotografin: Anja Gross
KVA Horgen
Das chemische Element Wasserstoff ist in der Diskussion um die Energiewende immer wieder ein Thema. Doch das Gas, das in grossen Mengen auf der Erde vorkommt, hat grosse Nachteile: Seine Energiedichte ist gering, was Lagerung und Transport aufwendig macht.
Am Paul-Scherrer-Institut wurde deshalb ein Konzept entwickelt, das dieses Problem lösen soll, indem es mehrere bestehende Techniken kombiniert: Überschüssiger Sommerstrom wird zur Elektrolyse von Wasser genutzt. Bei letzerer werden die Wasserstoff- und Sauerstoffteilchen unter grossem Energieaufwand voneinander getrennt.
Zweiter Verarbeitungsschritt
So gewinnen die Forschenden Wasserstoff, den sie aber direkt weiterverarbeiten. Durch die so genannte Sabatier-Reaktion, die unter erhöhten Temperaturen in einem Druckbehälter abläuft, entsteht aus Wasserstoff (H2) und Kohlendioxyd (C02) neben Wasser auch das Edelgas Methan (CH3). Übrig bleibt dabei Sauerstoff. Über eine katalytische Reaktion wiederum reagieren Kohlendioxyd und Wasserstoff bei gegen 300 Grad Celsius zu einem flüssigen Alkoholmolekül (chemische Summenformel CH3OH). Beide Stoffe lassen sich einfach speichern, transportieren und wieder in Energie umwandeln.
Kohlendioxyd fällt in Kehrichtverbrennungs- oder Biogas-Anlagen in grossen Mengen an, weshalb für das aktuelle Projekt die KVA in Horgen am Zürichsee den idealen Standort bietet: Die erst 2016 modernisierte Kehrichtverbrennungsanlage hat genügend Platz für die zusätzlichen Anlagen, und die Distanz für den Transport des Methanols zum Abnehmer in Bassersdorf ist überschaubar. Das Methan wiederum lässt sich ins Erdgasnetz einspeisen. (bk)
Fünf Reserve-Kraftwerke
Nicht nur Fahrzeuge und Gebäude, sondern auch Notkraftwerke sollen in Zukunft möglichst klimaneutral betrieben werden. Denn Strom ist nicht nur der Schlüssel für die Energiewende, sondern auch im Alltag unverzichtbar: Ein Blackout stellt das wirtschaftlich grösste Sicherheitsrisiko in der Schweiz dar.
Der Bund plant deshalb den Bau von fünf Reserve-Kraftwerken, um gegen einen totalen Stromausfall gewappnet zu sein. Eines der Kraftwerke soll im Auhafen Muttenz nahe Basel zu stehen kommen. Das Notkraftwerk des Energieversorgers Axpo soll dereinst Strom für 600’000 Haushalte liefern können, womit es das grösste in der Schweiz sein wird.
Die Anlage soll umweltfreundlich betrieben werden. Dies mit dem so genannten HVO-Diesel: erneuerbarem Diesel, der aus altem Pflanzenöl gewonnen wird. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Anlage aber auch mit E-Methanol betrieben werden können.
Die Inbetriebnahme des Kraftwerks ist für den Winter 2029/30 vorgesehen; die Kosten sollen sich im mittleren dreistelligen Millionenbereich bewegen. (bk)