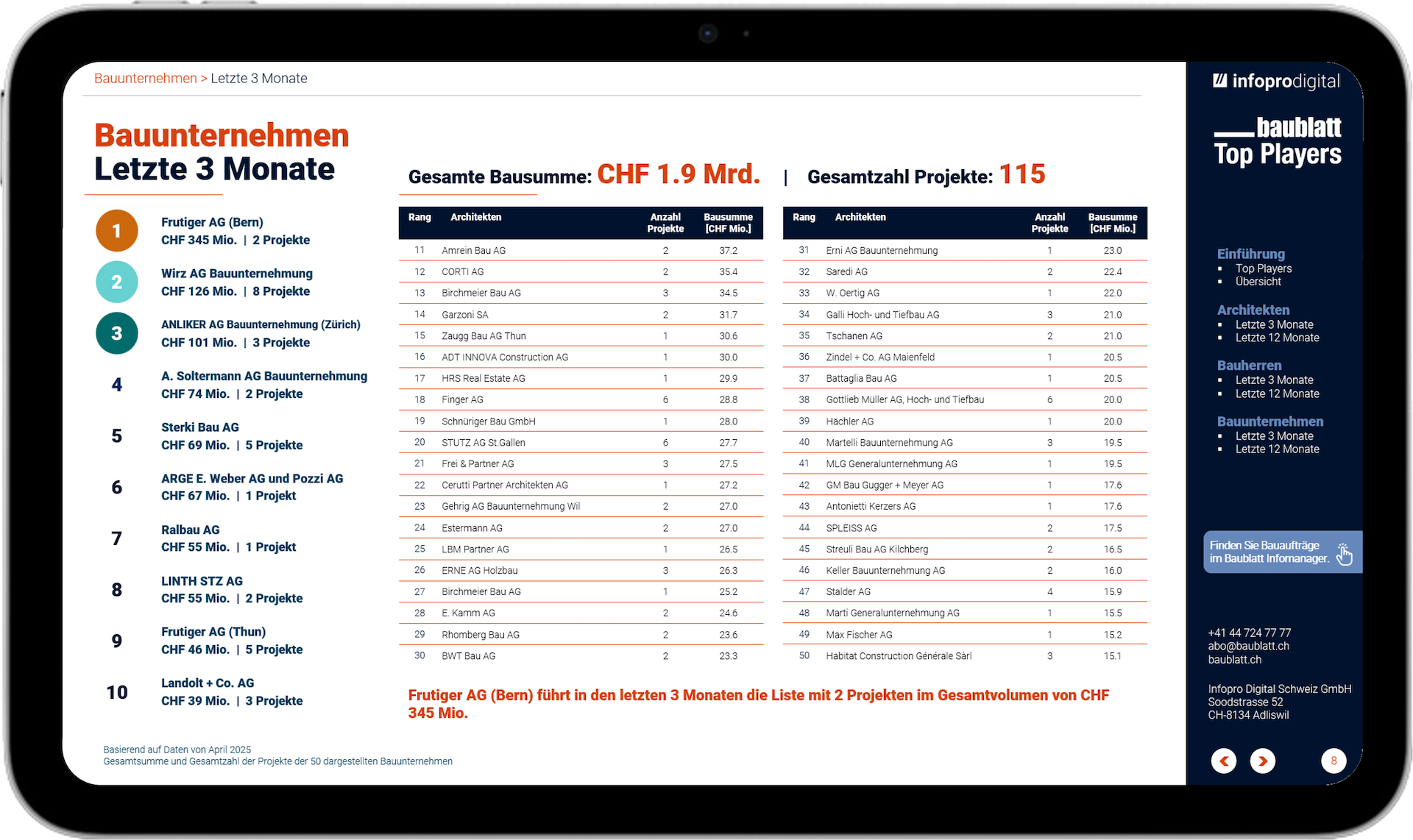Studie: Der Rhein wird wärmer
Die steigenden Temperaturen im Wasser des Rheins wirken sich auch auf Ökologie und Wirtschaft aus, diese Entwicklung dürfte sich in Zukunft verstärken. Dies zeigt eine deutsch-niederländische Studie im Zusammenhang mit der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), mit der erstmals ein länderübergreifender Modellansatz erprobt worden ist, der Modellergebnisse aus der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden entlang eines einheitlichen Klimasignals miteinander vereint.

Quelle: Michael Musto, eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
Der Rhein bei Köln im trockenen Sommer von 2018.
In diesem Frühling lag der Pegel des Rheins klar unter dem langjährigen Durchschnitt. Und oft geht Niedrigwasser geht mit hohen Wassertemperaturen einher. Dass sich der Rhein deutlich erwärmt, zeigt eine aktuelle Untersuchung, die das niederländische Forschungsinstitut Deltares und die deutschen Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) im Rahmen ihrer Arbeit für die Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) . «Solche Bedingungen sind ein Vorgeschmack auf das, was wir in Frühling und Sommer zukünftig häufiger für den Rhein erwarten dürfen», kommentiert IKSR-Präsidentin Miriam Haritz die Studienresultate.Die Auswertung der Messreihen für den Zeitraum 1978 bis 2023 habe bereits einen klaren Erwärmungstrend gezeigt, teilt die IKSR dazu mit.
Insbesondere im Raum südlich von Karlsruhe erhöhten sich die Wassertemperaturen im Rhein seit 1978 augenfällig: So stieg in Basel die durchschnittliche jährliche Wassertemperatur im Untersuchungszeitraum um 0,4 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Der Rückgang menschgemachter Wärmeeinleitungen– etwa wegen abgeschalteter Kernkraftwerke – konnte den Anstieg der Wassertemperaturen nicht kompensieren.
Wassertemperatur könnte bis 2100 um 2,9 bis 4,2 Grad ansteigen
Die Basis für die für die Studie durchgeführten, neuen Simulationen der Wassertemperaturentwicklung lieferte das CO2-Hochemissionsszenario des Weltklimarats (IPCC). Um den zu erwartenden Anstieg der Rheintemperaturen zu quantifizieren, führten die Fachleute von BfG, Deltares und den Anrainerstaaten Modellrechnungen durch: Sie nehmen an, dass sich der Rhein im Bereich von 1,1 bis 1,8 °C bis zur Jahrhundertmitte erwärmt. Bis zum Jahr 2100 könnte die jährliche mittlere Wassertemperatur sogar um 2,9 bis 4,2 Grad Celsius zunehmen, gegenüber dem Zeitraum von 1990 bis 2010. Er ist als Referenz für alle Berechnungen herangezogen worden. Von dieser Entwicklung dürften vor allem die südlichen Rheinabschnitte von der Schweiz bis Karlsruhe betroffen sein, auch das geht aus der Untersuchung hervor.
Konkret heisst dies: Im Rheinhauptstrom dürfte sich die Anzahl der Tage mit Temperaturen unter 10°C gemäss Studie bis zum Ende des Jahrhunderts von aktuell 170 Tagen pro Jahr auf 104 Tage sinken. Umgekehrt wird sich die Zahl der Tage mit Temperaturen über 21,5 °C erhöhen: Von derzeit durchschnittlich 32 Tagen auf 106 Tage, von welchen wiederum an 50 Tagen Temperatur über 25 Grad Celsius und bis zu 28 Grad Celsius herrschen. Überdies könnten die modellierten Wassertemperaturen laut den Studienautoren überschritten werden, und zwar aufgrund von Faktoren, die in der Studie nicht berücksichtigt worden sind, vor allem durch schwer vorhersagbare menschgemachte Wärmeeinleitungen.
Wenn sich der Wels ausbreitet und die Äsche schwindet

Quelle: Marcus Elieser Bloch. Original aus der New York Public Library, digital aufbereitet von Rawpixel
Wird das Wasser wärmer, fühlt sich der Wels (Silurus Glanis) zunehmend wohler und breitet sich damit auch aus. (Illustration aus "IIchtylogie, ou Histoire naturelle: génerale et particuliére des poissons (1785–1797)" von Marcus Elieser Bloch)
Weil mit der Klimaerwärmung auch die Lufttemperaturen steigen, geraten tendenziell alle Lebensräume unter Druck. Wie aus der Studie weiter hervorgeht, leiden Lebensräume im Wasser und in Feuchtgebieten wegen der immer öfter vorkommenden, heftigeren Niedrigwasser und wegen der steigenden Wassertemperaturen besonders unter dem Klimawandel. Hinzu kommen noch die vom Menschen verursachten Auswirkungen auf die Wassertemperatur. «Die steigenden Wassertemperaturen beeinflussen die Lebensbedingungen im Rhein erheblich», sagt dazu Tanja Bergfeld-Wiedemann, BfG-Wissenschaftlerin und eine der Studienautorinnen. «Werden kritische Temperaturschwellen über längere Zeiträume überschritten, kann es zu ökologischen Schäden kommen. Aquatische Organismen leiden dann beispielsweise unter Hitzestress, was sie schwächt und anfälliger für Krankheiten macht.» Bei höheren Temperaturen nehem ausserdem die Löslichkeit von Gasen im Wasser ab, wodurch den Tieren weniger Sauerstoff zur Verfügung steht.
Zudem ist wärmeres Wasser im Winter auch ein günstiger Nährboden für die Verbreitung gewisser invasiver gebietsfremder Arten. Langfristig könnte etwa der Bestand der kaltes Wasser bevorzugenden Äsche einbrechen, oder vielmehr aus Teilen ihres bisherigen Verbreitungsgebietes im Rheinsystem verschwinden. Derweil werden temperaturunempfindliche Raubfische wie der Wels gestärkt, sie üben dann einen zusätzlichen Druck auf Wasserlebewesen aus.
Laut Studie lässt sich der Anstieg der
Wassertemperatur in kleinen Nebenflüssen begrenzen, indem schattigen
Rückzugsgebiete geschaffen, Auwälder renaturiert und funktionierende
Auenökosysteme wieder hergestellt werden. Allerdings sind Massnahmen,
wie es weiter heisst, in grossen Nebenflüssen und im Rheinhauptstrom
seien Massnahmen schwieriger umzusetzen. (mai/mgt)