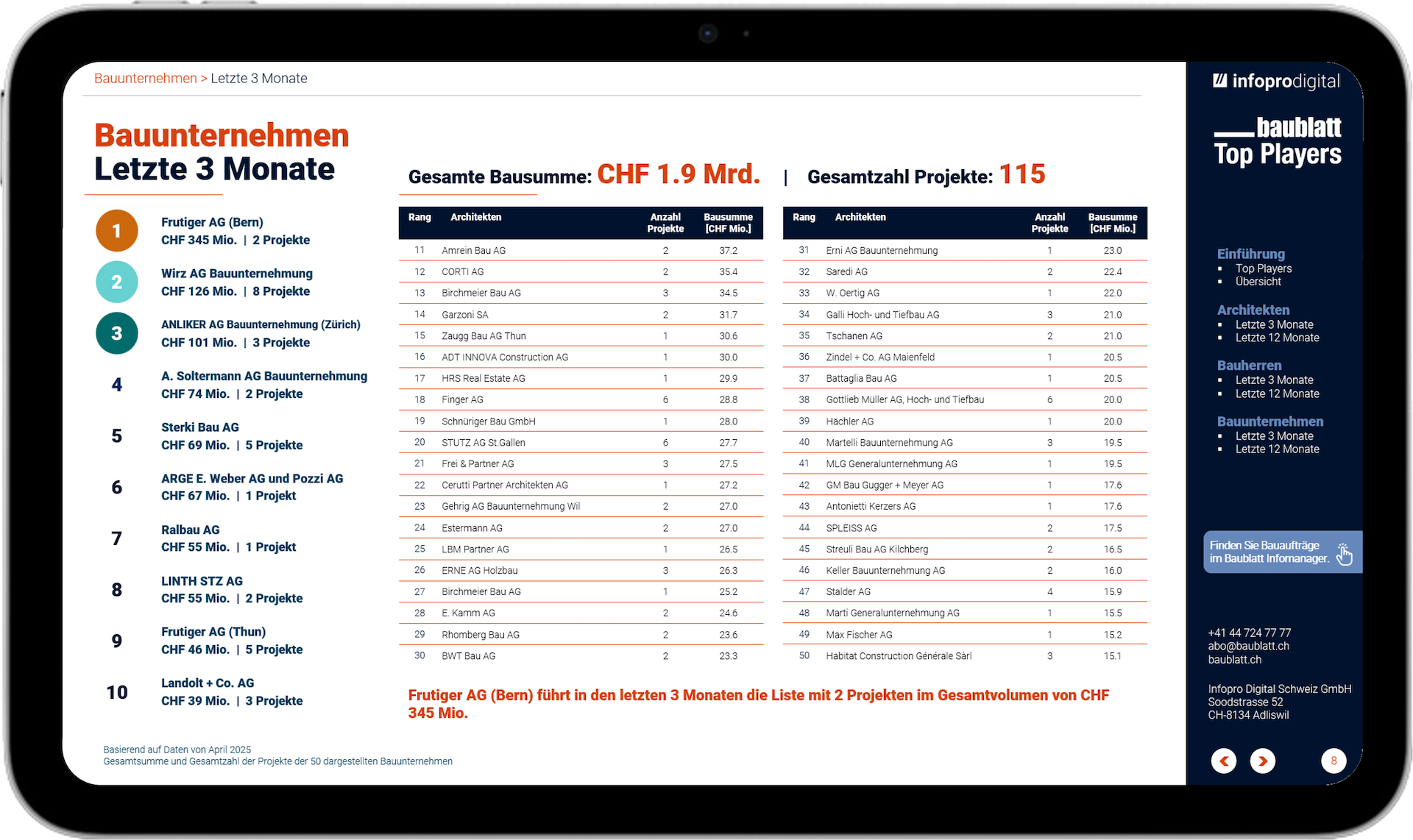Klimawandel lässt Gefahr von Erdbeben am Mont-Blanc-Massiv steigen
Im Bereich des Mont-Blanc-Massivs kommt es seit rund zehn Jahren wiederholt zu vielen kleinen Erdbeben. Eine Studie des Schweizerischen Erdbebendienstes, des Bureau des Recherches Géologiques et Minières in Montpellier und des Institut de la Terre in Grenoble belegt nun erstmals, dass dies mit den klimabedingten Veränderungen im vergletscherten Hochgebirge zusammenhängt.

Quelle: Nicolas Vigier, CC0
Die Grandes Jorasses vom Norden her gesehen; Sie sind ein mehrgipfelliger Berg des Mont-Blanc-Massivs, an der Grenze zwischen Frankreichs und Italien.
Das Mont-Blanc-Massiv im Dreiländereck von Frankreich, Italien und der Schweiz umfasst neben dem Mont Blanc zehn weitere Viertausender. Dazu gehört auch der Gebirgszug der Grandes Jorasses, unterhalb dessen sich seit rund zehn Jahren eine deutlich ausgeprägte, anhaltende Erdbebensequenz bemerkbar macht. Die Beben folgen einem saisonalen Muster und häufen sich vor allem im Herbst, zuvor sind hier nur vereinzelt solche Bewegungen registriert worden. Könnte diese Entwicklung mit dem Klimawandel zu tun haben? Der Schweizerische Erdbebendienst, das Bureau des Recherches Géologiques et Minières und das Institut de la Terre konnten dies erstmals in einer Studie belegen.
In diesen Gebieten lassen die Hitzewellen den Permafrost tauen, womit sich die Gletscherschmelze beschleunigt und Felsstürze zunehmen. Zudem sucht sich das Schmelzwasser im Zuge all dessen neue Wege, was wiederum den Porenwasserdruck bis in tief ins Gestein beeinflusst und dort die Spannungsverhältnisse verändert. Die Folge: eine verstärkte Erdbebenaktivität in Regionen, in denen bisher keine Erdbeben beobachtet worden sind.
Wenn Gletscher schmelzen und der Permafrost taut, findet Schmelzwasser neue Wege in die Tiefe. Flache Beben hängen mit dem Abfluss vom letzten Jahr zusammen, tiefere mit dem von vor zwei Jahren.
600 Meter lange, wasserdurchlässige Schwächezone
Wie die SED dazu schreibt, verläuft im Gestein unter dem Mont-Blanc-Massiv und der Grandes Jorasses eine bis zu 600 Meter breite, wasserdurchlässige Schwächezone. Sie sorgt dafür, dass das Schmelzer leichter versickern kann. Wie Forschungsteam nun in seiner Studie festgestellt hat, dringt entlang dieser Zone junges, kaltes Schmelzwasser von den rund 2’500 Meter höher gelegenen Gletschern innerhalb von 70 Tagen in den Mont-Blanc-Tunnel hinab. - Die Erdbeben konzentrieren sich entlang dieser tektonischen Schwächezone, und zwar unter dem Tunnelniveau, in Tiefen von bis zu acht Kilometern.
Dank Modellierungen fanden die Wissenschaftler nun heraus, dass das dort eindringende Schmelzwasser mit einer Verzögerung von mehreren Monaten bis mehrere Jahre den Porenwasserdruck erhöht und so die seismische Aktivität verstärken kann. Konkret bedeutet dies: Der Porenwasserdruck schwächt die stabilisierende Gebirgsspannung, die senkrecht auf die Gesteinsflächen wirkt. In der Folge können sich Scherspannungen, die parallel zu diesen Flächen wirken, leichter abbauen, was wiederum Erdbeben verursacht.
Drastischer Anstieg der Erdbebengefährdung in der kalten Jahreszeit
Für seine Studie hat das Forschungsteam über 12’000 Mikroerdbeben aufgespürt, untersucht und ausgewertet, die zwischen 2006 und 2022 unterhalb der Grandes Jorasses aufgetreten sind. Laut SED zeigte sich, dass die Erdbebengefährdung seit 2015 zehnmal höher ist als zuvor. Äusserst drastisch ist der Anstieg bei der kurzzeitigen Erdbebengefährdung in den kalten Monaten von Herbst bis Frühjahr: Er ist um das bis zu 10’000-Fache höher.
Für die Studie untersuchten die Fachleute, wie gross die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben der Magnitude 3 oder höher innerhalb der nächsten 24-Stunden ist. In der kalten Jahreszeit respektive in Phasen mit einer erhöhten Erdbebenaktivität kann sie bei mehr als zehn Prozent liegen: Im langfristigen Durchschnitt ist somit alle zehn Tage mit einem Beben dieser Stärke zu rechnen. Wie der SED in schreibt, ereignete sich eine solche Hochphase im März 2019 statt, damals wurde auch das bislang stärkste Erdbeben der Sequenz mit einer Magnitude von 3.1 verzeichnet. Dies untermauert laut SED die Ergebnisse der Studie. Die Studie könne jedoch nur die relative Veränderung der Erdbebengefährdung zuverlässig darstellen, so der Dienst. Um verlässliche, absolute Werte angeben zu können, wären weiterführende Unterin suchungen erforderlich.
Erkenntnisse dienen der Erdbebenvorsorge
Auch wenn saisonale Schwankungen der Erdbebenaktivität infolge von Veränderungen des Porenwasserdrucks schon in anderen Weltregionen beobachtet worden sind, belegt die schweizerisch-französische Studie doch erstmals, dass dieses vom Klimawandel begünstigte Phänomen zu einer deutlich höheren lokalen Erdbebengefährdung führen kann. Für die Studienautoren ist dies eine wesentliche Erkenntnis für eine bessere Erdbebenvorsorge in alpinen Regionen. Können diese doch künftig möglicherweise verstärkt mit Erdbeben infolge klimatischer Veränderungen konfrontiert sein. Davon ist nicht nur das Mont-Blanc-Massiv betroffen, sondern hochalpine und arktische Gebiete weltweit. (mgt/mai)