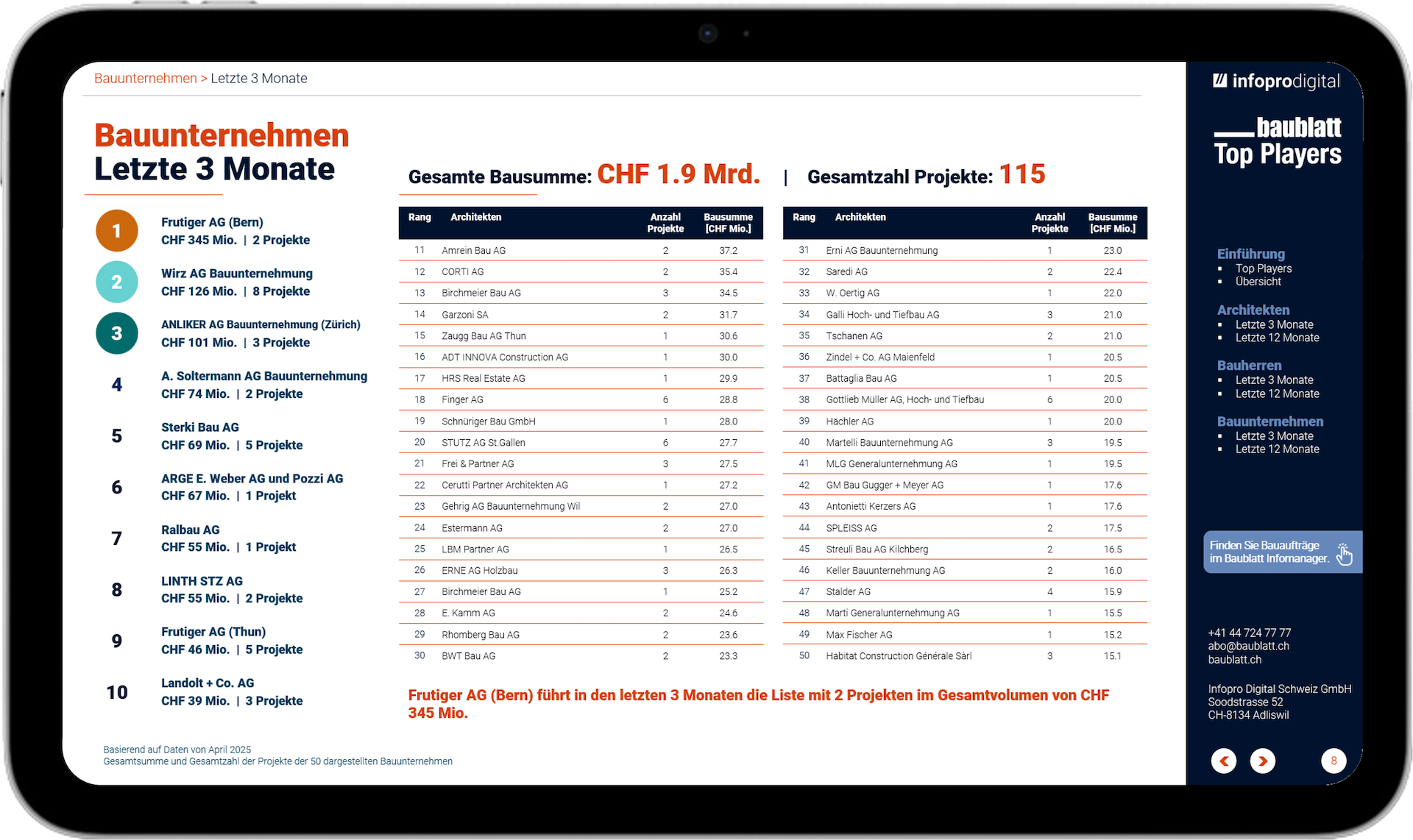Fantasie lohnt sich
Auf vielen Spielplätzen steht heute nicht mehr das Spielen, sondern die Sicherheit im Vordergrund. Unter zertifizierten Schaukeln liegen normgerechte Fallschutzplatten, Hinweisschilder oder «Benützungsordnungen» belehren über das richtige Verhalten, und zahlreiche Eltern bringen ihre Kinder nur noch in Schutzkleidung und mit Velohelm auf den Spielplatz.
Wenn aus Spiel derartiger Ernst wird, stellt sich die Frage nach den Gründen. Vielleicht spiegelt sich im modernen, sauberen Spielplatz das Sicherheitsbedürfnis einer Gesellschaft, die von diffusen und schwer zu berechnenden Gefahren bedroht wird, darunter Natur- und Technikkatastrophen, Terroranschläge oder der wirtschaftliche Abstieg. Vielleicht zeigen solche Spielplätze aber lediglich den zunehmenden Druck des Haftungsrechts. Denn während früher ein Schild mit der Aufschrift «Eltern haften für ihre Kinder» noch genügen mochte, sind heute Konstruktion und Montage von Spielgeräten mit detaillierten Normen geregelt, und die Unfallverhütung auf Spielplätzen geniesst auch beim Bund grosse Aufmerksamkeit. Im Bestreben, einen guten Spielplatz zu bauen, konzentrieren sich deshalb viele Gemeinden auf die rechtlich einwandfreie Ausführung.
Seit 1995 ein Kind auf einem Spielplatz in Winterthur tödlich verunglückte, hat sich in vielen Städten und Dörfern ein regelmässiger Unterhaltsdienst etabliert. Diese Anstrengungen sind zweifellos löblich. Jedoch stellt sich die Frage, ob zwischen Wartungsintervallen und Sicherheitsnormen nicht eine banale Wahrheit vergessen geht: Ein Spielplatz ist zum Spielen da.
Was wollen die Kinder?
Doch wie wollen, wie können Kinder spielen? Welche Bedingungen, welches Material brauchen sie dazu überhaupt? Antworten auf diese Fragen könnten die meisten Gemeinden im eigenen Haus holen. In allen Kantonen gibt es Psychomotorik-Therapiestellen, die von der öffentlichen Hand getragen werden. Hier finden Kinder mit motorischen Schwierigkeiten, mit Aufmerksamkeits- oder Wahrnehmungsproblemen kundige Unterstützung. Durch Bewegungs- und Rollenspiele lernen sie beispielsweise, ihre Bewegungen besser zu kontrollieren, negative Gefühle ohne Schaden für ihre Umwelt auszudrücken oder spielerisch ihre Blockaden zu überwinden.
Ein wesentliches Element der Therapie ist das Spielen, und so ähneln die Psychomotorik-Stellen gewissermassen einem Spielplatz unter der Lupe: Die Aktiven dürfen sich austoben, die Ängstlichen mutiger werden. Die Abgelenkten üben, sich zu konzentrieren und die Verkrampften, sich zu entspannen. So zeigt sich exemplarisch, wie wichtig das zuweilen belächelte Spielen für die individuelle Entwicklung des Menschen ist: Fantasie und Empathie für andere werden ebenso trainiert wie Geschicklichkeit, Balance und Selbstüberwindung. Oder anders gesagt: Spielen ist Lernen.
Veränderbare Welten
Innerhalb der Schuldienste ist die Psychomotorik-Therapie meist ähnlich organisiert wie die Logopädie. Häufig sind die Therapiestellen sogar auf kommunaler Stufe angesiedelt. Das Wissen über das Spielen wäre also durchaus vorhanden. Bis heute sind in der Schweiz jedoch kaum Spielplätze bekannt, für deren Gestaltung auch Psychomotoriktherapeutinnen einbezogen worden sind. Dabei wären von den Fachfrauen und -männern durchaus interessante Antworten zu erwarten. Sie kennen die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder aus erster Hand und können eine Sicht einbringen, die ungewohnt, aber bereichernd ist.
Das fängt bei der Ausstattung einer neuen Anlage an. Fragt man einen Fachmann, wie denn der optimale Spielplatz aus psychomotorischer Sicht aussehen sollte, folgt mitnichten eine Aufzählung von Spielgeräten. «Ein Spielplatz darf nicht fertig gestaltet sein, sondern muss ausgehandelt werden», sagt Daniel Jucker, Psychomotorik-Therapeut und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Dieses Plädoyer für das Unfertige hat einen guten Grund: «Eine fertige Welt verhindert, dass sich das Kind als selbst wirksam erlebt», sagt Jucker. Deshalb sei es nötig, den Kindern Raum für eigene Erfahrungen zu lassen und statt einem fixfertigen Spielhaus beispielsweise lose Bretter und Plachen für eigene Spiele bereitzustellen. In einer solchen «Bewegungsbaustelle» stellen sich auf einmal Fragen wie: Warum stürzt meine Brücke ein, wenn ich zu lange Bretter nehme? Wie muss ich ein Brett auf einen Holzrugel legen, um mit diesem Katapult etwas wegschleudern zu können? Wo ist die Grenze zwischen Balancieren und Umfallen?
«Wer auf einem Spielplatz niemals Risiken erleben und ausloten konnte, ist im Strassenverkehr sehr gefährdet», sagt Jucker. Ein Spielplatz dürfe und solle kein gefährlicher Ort sein, aber doch ein Ort, an dem sich Grenzen erfahren liessen: «Das Ziel ist nicht das Chaos, sondern der Chaosrand. Der Moment, in dem man scheitern könnte, aber nicht scheitern muss.» Durch Spiele wie «Brückenbau» oder «Katapult» können die Kinder nicht nur physikalische Gesetzmässigkeiten erfahren. Beim gemeinsamen Experimentieren mit anderen Kindern üben sie auch soziale Beziehungen ein – und nicht zuletzt ihre eigene Beziehung zur Welt.
Ungehobelt und real
Diese Welt ist heute zunehmend von Künstlichem geprägt. Laut Jucker müssen die Spielplätze deshalb ein Stück weit die Funktion eines Ersatzbiotops übernehmen. Um den schwindenden Bezug zum Natürlichen wieder herzustellen, sei eine naturnahe Gestaltung besonders wichtig. Das lässt sich beim Bau einfach umsetzen, etwa bei der Konstruktion von Geräten oder Spielhäusern. Statt glatt gehobelten, druckimprägniertem Industrieholz lassen sich auch natürlich gewachsene Baumstämme verwenden. Mit ihrer Rinde, ihren Ästen und Schrunden sind sie keine Simulation der Natur, sondern ein Teil davon. Wer über einen knorrigen Baumstamm geht, muss anders und besser balancieren als auf einem glatt geschliffenen Rundholz. Auch die Wege können ganz unterschiedlich gestaltet werden. In Lommiswil SO gibt es etwa verschiedene Pfade, die mit Sand, Schotter oder Holzprügeln gestaltet sind. Nicht nur das Spielen, auch das Gehen wird so zu einer Erfahrung von Unterschieden, verschiedenen Möglichkeiten und Begrenzungen. Am Wichtigsten ist neben dieser Vielfalt, die Möglichkeit, eigene Erfahrungen machen zu können.
Wunschlisten nicht abtun
Neben diesen Bedürfnissen haben die Jüngsten natürlich auch klare Vorstellungen, was die Gestaltung ihrer Spielplätze angeht. «Ein Hallenbad, eine 100 Meter lange Rutschbahn und einen Kiosk!» Diese drei Wünsche hört Hansjürg Baumberger oft, wenn er Kinder fragt, was sie am liebsten auf ihrem neuen Spielplatz sehen würden. Der Spielplatzbauer aus Wimmis BE sagt, man müsse die utopischen Wünsche zur Kenntnis nehmen und danach geduldig weiterfragen. Denn Kinder haben noch kein Bewusstsein für Kosten. Deshalb ist es wichtig, ihnen zu erklären, dass ein Raumschiff vielleicht nicht bezahlbar ist, dafür ein Piratenschiff mit Klettergerüst. Oder ein Gerät oder Gebäude, das es noch gar nicht gibt, das aber gebaut werden kann. Was nach Baumbergers Erfahrung nichts bringt, sind Alibiübungen. Wer die Kinder nur zum Schein einbezieht, ihre Wünsche dann aber als «unbezahlbar» wertet und Standardmobiliar aufstellt, darf sich nicht wundern, wenn der Spielplatz auf wenig Begeisterung stösst.
Bequemes ist oft langweilig
Weshalb aber gibt es so viele Spielplätze, die trotz guter Absichten eher fantasielos wirken? Für Baumbergers Geschmack wird zu häufig nach den Katalogen der Hersteller gegriffen: «Man möbliert den vorhandenen Raum mit Nullachtfünfzehn-Geräten und erhält damit auch einen Nullachtfünfzehn-Spielplatz.» Dabei würde etwas mehr Kreativität nicht schaden. Statt vorgefertigte Elemente zu verbauen, entscheiden Baumberger und seine Mitarbeiter meistens vor Ort, wie ein Problem gelöst werden kann. So wirkte etwa der Eingang zu einer Kriechröhre auf dem Spielplatz am Lenkersee seltsam ungemütlich. Die zündende Idee für die Gestaltung hiess «Wilder Westen»: Mit Brettern wurde die Öffnung so gestaltet, dass sie aussieht wie der Eingang zu einer Mine. Das Planen vor Ort und die Anpassung an die Verhältnisse waren auch Maximen für das «Niesendörfli», ein Spieldorf auf 2230 Metern über Meer.
Eine grosse Rolle spielt natürlich der verfügbare Platz. Auf 200 Quadratmetern Pausenplatz ist ein attraktiver Spielplatz wesentlich schwieriger zu gestalten als auf der grünen Wiese. Und selbst in ländlichen Gebieten können Elternvereine ein Lied davon singen, wie schwierig die Suche nach einem geeigneten (und idealerweise kostenlosen) Areal ist. Doch es gibt auch Spielplätze, die Kinder und Planer gleichermassen zum Schwärmen bringen. Im Berner Oberland, in der Lenk, baut Baumberger gegenwärtig einen Spielplatz, von dem die meisten Gemeinden nur träumen können. Das Areal ist 7000 Quadratmeter gross, eines der spektakulären Bauwerke wird eine 14 Meter lange Hängebrücke sein. Statt «Spielelementen» aus dem Katalog stellt Baumbergers Team zahlreiche Eigenentwicklungen auf, darunter ein vor Ort gestaltetes Mikado aus Baumstämmen, das zum Klettern und Balancieren anregt.
Wird dieser Spielplatz nicht zu abenteuerlich und zu gefährlich für ein Land, in dem manchen überbehüteten Kindern auf dem Spielplatz nur noch die orange Leuchtweste fehlt? Baumberger winkt ab: «Viele Eltern würden ihre Kinder am liebsten in Watte einpacken. Sie haben Angst, dass ihr Kind auf dem Spielplatz eine ‹Sprisse› erwischt oder sich den Kopf anschlägt.» Das sei die falsche Haltung, ist der Vater von zwei Söhnen überzeugt: «Zu einem Spielplatz gehören auch mal Verletzungen wie Nasenbluten oder ein Beinbruch.»
Dass der Einbezug der Kinder auch konkrete Vorteile für den langfristigen Unterhalt der Anlagen bietet, weiss jeder Spielplatzbauer. Wie beim Schulbau gilt auch für Spielplätze: Was im Quartier akzeptiert und mitgetragen wird, bleibt vor Missachtung und Vandalismus verschont. «Was man selbst gebaut hat, macht man nicht kaputt», fasst Urs Aschmann, Planer beim Spielplatzbauer «No risk, no fun» seine Erfahrungen zusammen.
Motiviertes Mitmachen
Durch den Einbezug der Kinder und vor allem der Eltern lassen sich zudem Projekte umsetzen, die bei prekärer Budgetlage scheitern könnten. Der von Aschmann geplante Spielplatz in Schneisingen AG war bereits bewilligt, blieb aber aus finanziellen Gründen zwei Jahre lang blockiert. Engagierte Eltern setzten sich in der Gemeinde für das Projekt ein und überzeugten auch Kinderlose vom Nutzen eines Spielplatzes. Mit Fronarbeit hinter Pickel, Schaufel und Schubkarre gelang es der Spielplatzgruppe, die Kosten deutlich zu senken. Diese Partizipation hatte nicht nur finanzielle Vorteile, sondern hat auch den Spielplatz als etwas Eigenes etabliert.
Für den Psychomotoriker Daniel Jucker sollte ein Spielplatz ohnehin als Ort des Mitmachens und des Unfertigen begriffen werden: «Statt einen Platz fertig zu bauen, kann man ihn Jahr für Jahr erweitern und verwandeln.» Das verlangt weder viel Geld noch übertriebenen Aufwand. Nach der Eröffnung kann die Gemeinde beispielsweise Bretter oder Autopneus für eigene Spiele bereitstellen. Im nächsten Jahr liefert der Förster eine knorrige, dafür günstige Eiche, die als Kletterbaum platziert wird. Nochmals ein Jahr später wird dieser Baum von Kindergartenklassen mit selbstgebastelten Klangelementen verziert, und daneben wird ein Hügel aufgeschüttet. Als Projektarbeit können Oberstufenschüler im nächsten Jahr dann eine Brücke zwischen Kletterbaum und Hügel bauen. Nicht das Statische kennzeichnet so den Spielplatz, sondern die stetige Veränderung.
Spielplätze und Lehrpläne haben etwas gemeinsam: Interessant werden sie für die meisten Menschen erst, wenn sie eigene Kinder haben. Der mangelnde Bezug zum Thema führt dazu, dass viele Spielplätze so sauber ausgeführt werden wie auf dem Plan: Hier können die Kinder schaukeln, dort rutschen, in der Ecke neben der Bank steht noch ein Sandkasten. Dieser Glaube an das Normative erinnert an die Grundrisse, in welche Architekten früherer Generationen auch noch gleich Betten, Esstische und Nachttischlampen einzeichneten.
«Oft ist für die Auftraggeber das Wichtigste, dass ein Spielplatz die gesetzlichen Auflagen erfüllt. Dass er auch attraktiv sein und Spass machen kann, geht oft vergessen», sagt Clemens Basler von Hänggi Basler Landschaftsarchitekten in Bern. Der Vater zweier Kinder kennt den Unterschied zwischen langweiligen und interessanten Spielplätzen aus eigener Anschauung: «Es gibt mehr als Schaukel, Rutsche und Sandkasten. Kinder wollen sich auch verstecken können, balancieren oder an bestehenden Geräten ganz neue Spiele erproben.»
Raum für eigene Spiele
Doch die Angst vor haftungsrechtlichen Folgen und eine gewisse Bequemlichkeit führten oft zu uninspirierten Anlagen, meint Basler. Kein Wunder: Wer Geräte wie einen Kletterturm oder eine unkonventionelle Schaukel selbst entwickelt, muss diese von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) prüfen und abnehmen lassen. Da ist es natürlich viel einfacher, die zertifizierten Geräte aus dem Katalog zu wählen. «Ein Spielplatz sollte frei interpretiert werden können», sagt Basler. «Manchmal ist ein Element eine Ritterburg, manchmal eine Insel im Meer.»
Solche Ansprüche erfüllt der Spielplatz Studerstein, den Hänggi Basler für den Berner Verein Kind, Spiel & Begegnung auf der Autobahnüberdeckung Neufeld gebaut haben. Weil der Platz in der Waldzone liegt, orientierte man sich bei der Gestaltung an den Auflagen der Forstverwaltung. So wurden nur einheimische Bäume und Sträucher gepflanzt, und alle Einrichtungen können entweder einfach entfernt werden oder würden sich selbst auflösen, falls der Spielplatz dereinst geschlossen wird. Befestigte Wege und Fallschutzplatten fielen so weg – dafür dienen Holzschnitzel als Dämpfer, und auf den Pfaden kommt das Wald-Gefühl auf. Die Grundlage des Spielplatzes bildet eine modellierte Landschaft, die im Kontrast zum topfebenen Gelände ringsum steht. So entsteht eine spannende räumliche Kulisse für die Kinder und Erwachsenen. Das ganze Areal ist mit Bäumen und Sträuchern durchsetzt. Ihr Wachstum wird den Faktor Zeit und die damit verbundenen Veränderungen eindrücklich illustrieren.
Neben einigen wenigen Installationen wie Rutsche, Seilbahn, Himmelsschaukel und Feuerstelle bietet der Spielplatz Studerstein vor allem natürliche Materialien*. Ein grosser, tiefer Sandkasten, Kies- und Schotterflächen laden ebenso zum Spielen ein wie Rasen- und Wiesenflächen, Holzbretter und -rugel und Kletterbäume.
Weil es noch bis zu 20 Jahre dauern wird, bis die schnellwüchsigen Bäume eine gewisse Höhe erreicht haben, sind im Gelände zahlreiche hohe Pfosten aus Kastanienholz verankert. Sie können für viele Zwecke genutzt werden: Je nach Bedürfnis lassen sich Sonnensegel oder Regenblachen spannen, können temporäre Baumhäuser konstruiert oder begehbare Seile (Slacklines) gespannt werden. Das sind jedenfalls die Ideen der Erwachsenen. Die vielen hundert anderen Verwendungszwecke der Pfähle werden die Berner Kinder im Laufe der nächsten Jahre selbst herausfinden.
Inspirationen für Gemeinden
Der Königsweg zum guten Spielplatz ist der Praxistest: Sind beschattete Bänke ein Luxus oder eine Notwendigkeit? Spielen wirklich alle Kinder gerne mit Wasser? Was erlaubt kreativere Spiele – das Schaukeltier oder ein Dutzend Holzrugel? Solche Fragen kann nur beantworten, wer selber mit Kindern auf verschiedene Spielplätze geht und sich für die Beantwortung genügend Zeit lässt. Der Besuch von bestehenden Anlagen schärft den Blick für gute Lösungen und macht vor allem eines klar: Spielen heisst kreativ sein, und je mehr Kreativität ein gestalteter Spielraum erlaubt, desto besser erfüllt er seinen Zweck.
Spielplätze für Schulhäuser
Der Platz ist beschränkt, das Budget ebenso. Wie können Gemeinden auf ihren Schularealen trotzdem ansprechende Spielplätze bauen? Hansjürg Baumberger empfiehlt, sich vor allem an den Benutzergruppen statt an der Möblierung zu orientieren. Nach seiner Erfahrung sind es fünf Gruppen, deren Bedürfnisse abgedeckt werden müssen:
- Die Ruhigen: Sie wollen sich auf dem Spielplatz zurückziehen, miteinander plaudern und ihr Znüni essen können.
- Die Sportlichen: Sie wollen sich austoben, und nicht zu knapp: Fussball und Handball, Tischtennis oder Basketball sind genau nach ihrem Geschmack.
- Die Bewegungsfreudigen: Sie wollen klettern, balancieren und etwas wagen. Dazu benötigen sie etwa Schaukeln, Drehtische, Hängematten oder Kletterbäume.
- Die Kreativen: Sie wollen etwas Eigenes schaffen, am liebsten mit Wasser und Sand, Schwemmholz, Lehmsteinen oder Flusskies.
- Der Abwart: Er sollte nicht mit einem fertigen Spielplatz konfrontiert, sondern von Anfang an einbezogen werden, damit es auch «seine» Anlage ist.
Von Michael Staub