Schweizer Lektionen: Wie bauen für 2048?
Klimawandel hin, Masseneinwanderung her: Weiterbauen wie gehabt kann die Schweiz nicht länger, findet die junge Architektengeneration. Morgen erscheint dazu ein Buch mit konkreten Lösungsvorschlägen.
Wie wird die natürliche und urbane Schweiz in 34 Jahren aussehen, wenn Wintersportorte nicht mehr genug Schneefall haben, wenn in den Agglomerationen sich mehr immer Menschen immer weniger Wohnraum und Verkehrsinfrastruktur teilen müssen? Werden es neun bis elf Millionen oder gar 14 Millionen Menschen sein, die sich 2048 das Schweizer Territorium von 41 285 Quadratkilometern teilen? Unterschiedliche Studien, unterschiedliche Antworten, unterschiedliche Zahlen. Ein merkliches Bevölkerungswachstum für die Schweiz bis 2048 sehen jedoch alle. Und ein Ansteigen der Schneefall- und Baumgrenzen sowie mehr Hochwasser durch das zunehmende Abschmelzen der Gletscher.
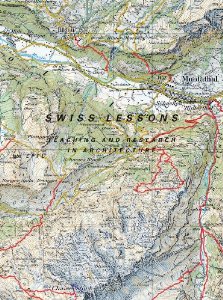
Quelle: Bild: zvg
Buchtitel Swiss Lessons: «Swiss Lessons - Teaching and Research in Architecture»
Was wir heute denken und tun, wirkt sich auf das Morgen aus. Gut oder weniger gut. Die Schweiz muss umdenken, sich den Herausforderungen aktiv stellen, finden Architekturstudierende. Deshalb erscheint am Dienstag im Rahmen der Leipziger Buchmesse das Buch «Swiss Lessons - Teaching and Research in Architecture». Das Laboratoire Bâle, das ETH-Architekturstudio in Basel, präsentiert darin konkrete Antworten für Dichtestress, demografischen und Klimawandel, die Architekturstudierende entworfen haben. Beispielgebend für die kommenden planerischen Herausforderungen der Schweiz, die nach Lösungen rufen, wurde der Nord-Süd-Landstreifen zwischen Basel und Zermatt analysiert. Mit zahlreichen Grafiken, Plänen und Fotografien illustriert, belässt das englischsprachige Buch es nicht bei der abstrakten Analyse, sondern zeichnet eine machbare Entwicklung für Geografie, urbane Metropolitanregionen, ländlichen Raum und Produktionszonen der Schweiz für die kommenden Jahrzehnte. Die Architekturstudierenden nehmen sich etwa der Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Strukturwandels in Skigebieten, der Einrichtung von neuen Naturschutzgebieten und der Stärkung des ökologischen, energieeffizienten Bauens mit Holz an.(tw)



