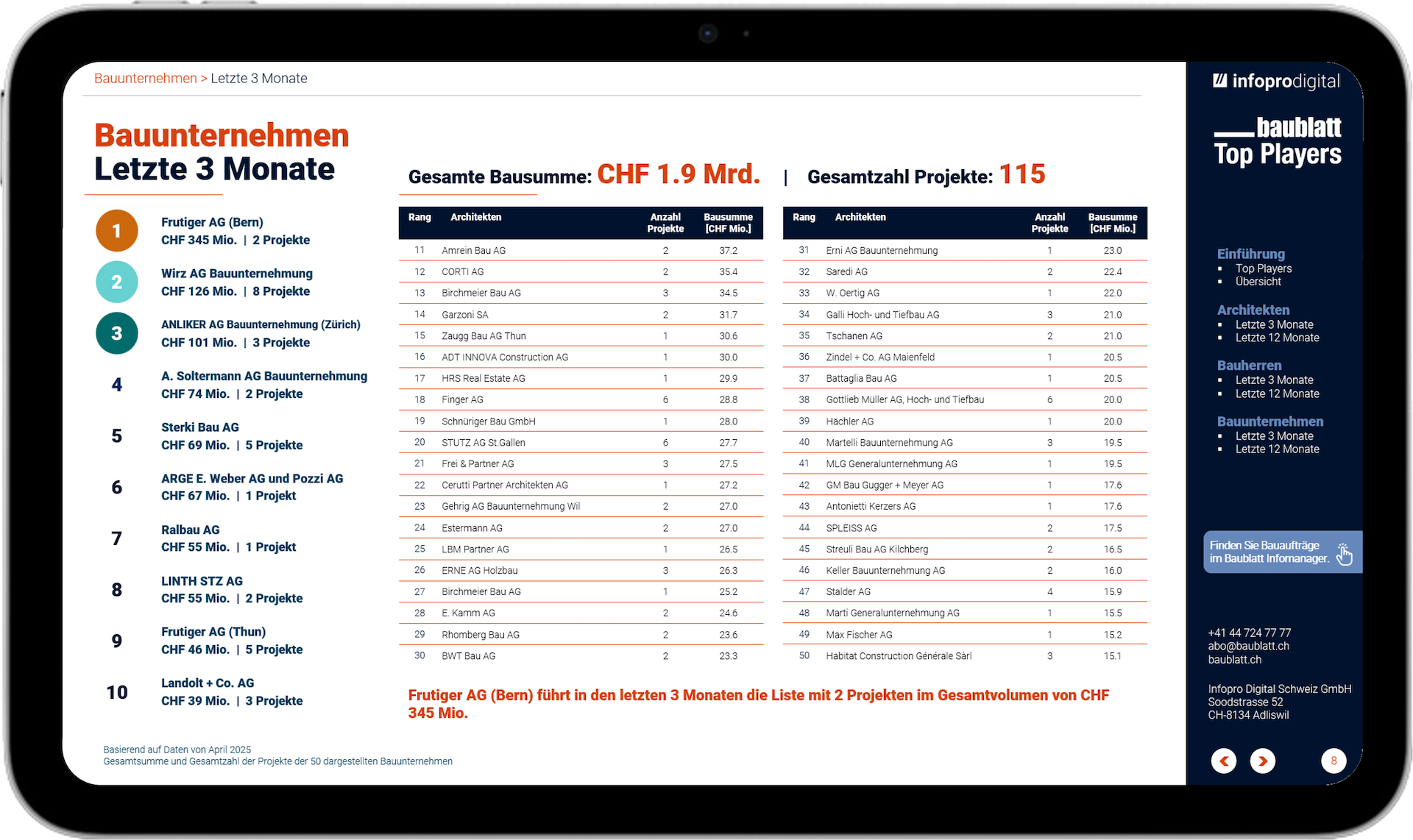Das Grauen und die Schönheit der Lawinen
Seit jeher gefährden Lawinen in den Alpen Menschen, Dörfer, Verkehrswege, Wälder und das Land. Der Luzerner Gletschergarten geht dem so faszinierenden wie gefährlichen Naturschauspiel mit einer Sonderausstellung auf den Grund.

Quelle: dahu1, Camptocamp.org, CC BY-SA 3.0
Lawine bei Zinal (VS) im März 2007.
Man weiss heute viel über Lawinen, über ihre Zusammensetzung und ihre Entstehung. Dennoch sind Prognosen für ihren Niedergang bis heute nicht möglich. Deshalb sind sie für Sicherheitsverantwortliche aber auch für die Forschung eine grosse Herausforderung. Bergbewohner leben seit Jahrhunderten mit der Lawinengefahr und haben sich deshalb im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Gefahr eingestellt, haben Schutzwälder unterhalten und gepflegt und dort gesiedelt wo sie vor Lawinen sicher waren.
Die Ausstellung thematisiert die Risiken und zeigt auf, welche Mittel es gibt die Lawinengefahren möglichst gering zu halten. Zudem geht die Schau auf die faszinierenden Seiten der Lawinen ein, seien es Vielfalt und Schönheit der Schneekristalle oder der eigentliche Lawinenniedergang. Gezeigt wird unter anderem ein sogenannter Kristallisator, auf dem man die Bildung eines Schneekristalles in Echtzeit beobachten kann. Auf Video-Clips gibt es eindrückliche Demonstrationen aus einem Lawinenzestgebiet des Schweizerischen Institutes für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos und der Suva. Diese beiden Organisationen haben zusammen die webbasierte Lawinenpräventations-Plattform „White Risk 2.0“ entwickelt, aus der grafische und interaktive Elemente in die Ausstellung integriert wurden.
Schon vor Jahrhunderten ein Thema
Lawinen sind in der Schweiz immer wieder ein Thema gewesen, in alten Chroniken und Berichten, in Ratsprotokollen und in spätmittelalterlichen Bannbriefen für den Erhalt der Schutzwirkung der Wälder. Gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz, wird zum Beispiel im Jahr 1440 von einer Lawine in Davos berichtet, die zwei Häuser zerstört und elf Menschen in den Tod gerissen hatte. Noch im 19. Jahrhundert war die Ansicht weit verbreitet, dass Lawinen vor allem aus riesigen Schneekugeln bestanden.
Die wissenschaftliche Erforschung der Lawinen begann erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. In seinem Werk „Die Lauinen der Schweizer Alpen“ vermittelte der damalige eidgenössische Oberforstinspektor Johann Wilhelm Fortunat Coaz wichtige Erkenntnisse über Entstehung, Verbreitung und Schäden von Lawinen, wie auch über geeignete Schutzmassnahmen. Und ab 1936 befasste sich das neu gegründete Eidgenössische Institut für Schnee und Lawinenforschung als erste Forschungsanstalt ihrer Art mit dem Thema. Auf der Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse entstanden überall in der Schweiz bauliche und planerische Schutzmassnahmen. Bis heute sind schweizweit 500 Kilometer Lawinenverbauungen entstanden. Ihre Bilanz ist eindrücklich: Während im Katastrophenwinter 1950/51 bei 1300 sogenannten Schadenlawinen 98 Todesopfer beklagt werden mussten, waren es im Katastrophenwinter 1998/99 mit 700 Schadenlawinen nur noch 17 Todesopfer. (mai)
Lawinen: White Glory - White Risk bis 14. September 2014
Adresse: Im Gletscher Garten Luzern, Denkmalstrasse 4, 6006 Luzern
Öffnungszeiten:bis 31.3. täglich von 10 bis 17 Uhr, vom 1.4. bis 31.10. täglich von 9 bis 18 Uhr
Weitere Informationen: www.gletschergarten.ch