Burgdorfer Geotechniktag: Bauen in schwierigen Böden
Baugrund ist kostbar. Deshalb werden immer häufiger schlecht geeignete Böden zum Bauen genutzt. Dies stellt die Planer und ausführenden Baufirmen vor neue Herausforderungen. Tiefenfundationen, Bodenverbesserungsmassnahmen oder Geomaterialien ermöglichen Bauten an bisher ungeeigneten Standorten.
Neuer Baugrund wird benötigt, um genug Platz für die wachsende Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Doch die Landreserven sind knapp und oft aufgrund rechtlicher Beschränkungen vor der Bebauung geschützt. Die Verdichtung bestehender Überbauungen sowie die Nutzung von bisher als ungeeignet eingestuftem Baugrund und belasteter Standorte sind oft die einzige Alternative. Der erste Burgdorfer Geotechniktag an der Berner Fachhochschule widmete sich diesen Herausforderungen. Er beleuchtete das Verhalten des Baugrunds und die baulichen Massnahmen.
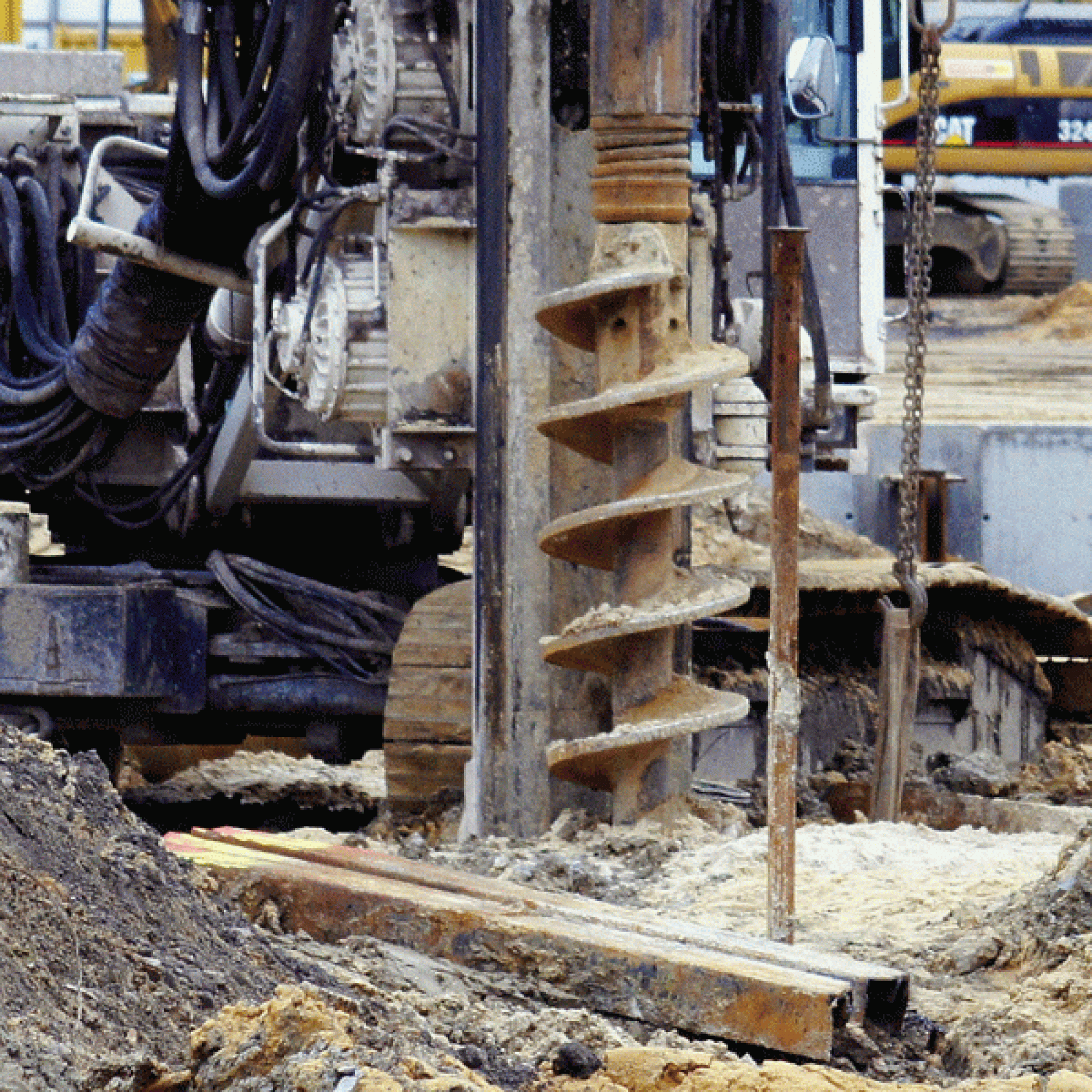
Reicht die Bodenstabilität für das Bauvorhaben nicht aus, schaffen Pfahlsysteme Standsicherheit im Gelände. (Bild: Hermann Kruse_Pixelio.de)
Um der geringen Tragfähigkeit, den Verformungen, dem stehenden oder strömenden Grundwasser sowie den Kriech- oder Rutschbewegungen gerecht zu werden, bieten sich immer mehr neue Techniken und Baustoffe an. «Es gab immer schon Methoden der Tiefenfundation. Die heute zur Verfügung stehenden Geräte erleichtern die Arbeit allerdings enorm, ebenso die neuen Berechnungsverfahren», erklärt Ulrich Trunk, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Tiefenfundation und Bodenverbesserung sind die gebräuchlichen Massnahmen, wenn die Tragfähigkeit des Bodens nicht ausreicht, sehr hohe Lasten abzuleiten sind oder unverträgliche Verformungen auftreten. Dabei wird der Baugrund so verbessert, dass ein Lastabtrag in Zusammenwirkung von Verbesserungselementen und Baugrund bei verträglichen Verformungen möglich ist. Die nicht ausreichend tragfähigen Schichten werden also durch diese Elemente überspannt.
Auch über Pfähle, Schlitzwandelemente oder Caissons können die Lasten in tiefere, besser tragende Baugrundschichten abgeleitet werden. «Bei Pfahlsystemen kommen regional sehr unterschiedliche Systeme zum Einsatz. Sie sind von der Geologie oder der Baugrundschichtung abhängig», so Ulrich Trunk. Die Pfahlsysteme unterscheiden sich in der Art des Lastabtrags und der Methode der Einbringung – wie Bohren, Rammen, Drehen und Vibrieren oder einer Kombination davon – sowie durch den Pfahldurchmesser.
Bei einer Baugrundverbesserung werden hingegen Massnahmen getroffen, welche die Eigenschaften des Bodens verändern. Dies ist unter anderem durch Verdichten und Beimischen anderer Materialien möglich. Auf diese Weise können auf dem verbesserten Baugrund auch Flachgründungen erfolgen. Der erforderliche Verbesserungsgrad sowie die Tiefe und Qualität des vorliegenden Baugrunds entscheiden über den zeitlichen, technischen und wirtschaftlichen Aufwand. «Nicht der Boden ist schwierig, sondern der anstehende Baugrund. Der Vorteil vieler Methoden ist, dass der Verbesserungsgrad an die wechselnden Baugrundverhältnisse und die zukünftige Nutzung angepasst werden kann», betont der Fachmann. Die Mehrheit der Massnahmen ziele auf eine Erhöhung der Scherfestigkeit oder Steifigkeit sowie auf die Minderung der Durchlässigkeit des Baugrundes. Die Grundlage dieser Arbeiten bilde deshalb immer eine vorangehende umfassende Baugrundanalyse. (cb)
Den kompletten Artikel lesen Sie im Baublatt Nr. 10, das am Freitag, den 11. März 2016, erscheint.



