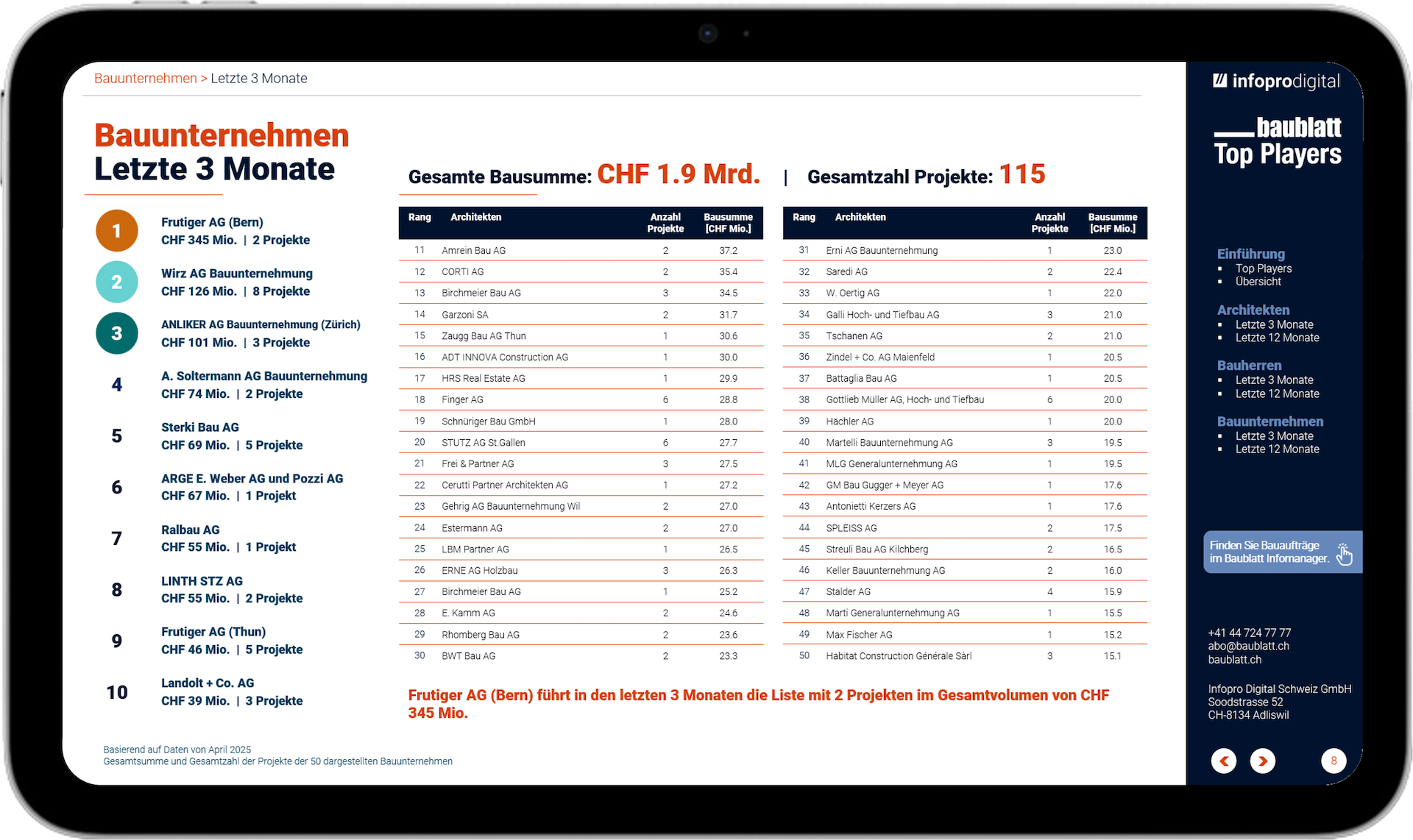Beschaffungswesen: Vergabepraxis verführt zu Dumpingpreisen
Exakt hinschauen will bei den Dumpingofferten niemand. Einzelne Baufirmen drücken sie ab – die Behörden greifen beim billigsten Angebot zu. Die Vergabepraxis muss dringend daraufhin geprüft werden, ob die eingespielten Wahlkriterien nicht einem ruinösen Wettbewerb dienten. Das forderte der Baumeisterverband an der diesjährigen Tagung von Infra Suisse.
Das öffentliche Beschaffungswesen setzt sich zum Ziel, die Staatsgelder wirtschaftlich einzusetzen, schreibt sinngemäss das Handbuch einer grösseren Verwaltung. Und: Mit einem Beschaffungsverfahren ist dazu das günstigste Angebot auszuwählen. «Damit kann sich auch die Baubranche einverstanden erklären», sagt Gian-Luca Lardi, der Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV). «Doch mit keinem Wort steht darin geschrieben, dass das Angebot ‹billig› sein soll», bringt er ein Übel auf den Punkt, gegen das die Baubranche
seit Jahren vergebens ankämpft.
Dabei legen Statistiken eine Realität offen, die zu denken geben müsste: «90 Prozent aller Zuschläge gehen an das billigste statt an das wirtschaftlichste Angebot, wie es das Vergaberecht ursprünglich vorsah», kritisiert Lardi. «Das hat zu einem ruinösen Preiswettbewerb geführt, zuerst bei den ausführenden Bauunternehmern, seit einiger Zeit aber auch bei den Planern.» Bei der Ausführung eines Projektes indessen erweist sich der Zuschlag für einen Bewerber mit einer Dumpingofferte immer wieder als wenig einträglich: «Schlechte Planung kostet den öffentlichen Bauherrn ein Vielfaches von dem, was er mit dem billigsten Angebot angeblich einspart.»
Eine paradoxe Situation fördert eine Analyse der Angebotsverteilung bei Offerteröffnung zutage: Zwischen dem billigsten und dem teuersten Bieter liegen die Preise oft 20 bis 30 Prozent auseinander. Die von einem Unternehmen für die Offerte getroffene bautechnische Lösung optimiert im Gegensatz dazu die Amtslösung zumeist um höchstens 5 Prozent. Noch krasser ist die Gegenüberstellung der grossen Preisdifferenz bei den Offerten im Vergleich zur Gewinnmarge der Bauunternehmen: Der Profit für eine Bauleistung liegt bei dünnen 2 bis 3 Prozent, wie Statistiken belegen.
Preisschlacht bringt nur Verlierer
Für Lardi ist der Fall damit klar: «Die grossen Preisunterschiede in den Angebotseröffnungen lassen sich nur mit Spekulation und Rabattschlachten erklären.» Das einzelne Bauunternehmen indessen kann aus einer solch zerstörerischen Preisspirale kaum ausbrechen: Es weiss nämlich genau, dass mit der Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent der billigste Anbieter den Zuschlag erhält.
Die Konsequenzen dieser Vergabe bezeichnet Lardi als «bitter und ruinös». Denn immer wieder decken die offerierten Preise die Baukosten nicht. Ebenso sind Auseinandersetzungen über eine Optimierung des Vertrags zwischen dem Auftraggeber und dem ausführenden Bauunternehmen so vorprogrammiert. Alles in allem erzeugt diese Situation auf vielen Baustellen eine «regelrechte Misstrauenskultur» aller Beteiligten. «Bauherrenvertreter, Planer und Baukader laufen so unserer Branche davon», befürchtet der SBV-Zentralpräsident. «Dabei wissen wir alle, dass der tiefste Angebotspreis nicht zwangsläufig zum tiefsten Realisierungspreis wird.»
Mathematische Dumpingbremse
Eine Lösung des Problems sieht Lardi, der selbst CEO eines Bauunternehmens ist, in einer marktbezogenen Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Nach heutigem Verfahren gilt: «Ein qualitativ hochwertiges Angebot darf höchstens wenige Prozentpunkte teurer sein als das tiefste Angebot.» Diese Praxis möchte er verändern, indem das Preiskriterium gegenüber anderen Kriterien nicht zu ausschliesslich gewichtet wird. «Der Preis muss wichtig bleiben, er darf aber nicht allein massgebend sein. Nicht also das billigste Angebot soll zum Handkuss kommen, sondern das wirtschaftlichste.» In anderen Worten heisst dass: Die höchste Punktzahl erhält nicht der günstigste Anbieter, sondern derjenige mit einem mathematisch berechneten «fairen Marktpreis» bezogen auf alle eingereichten Offerten.
«Mit dieser kleinen Änderung kann man sehr rasch die Preisspirale stoppen», ist Lardi überzeugt, «weil reine Dumpingpreise damit keine Garantie mehr sind für die erfolgreiche Auftragsbeschaffung.» Am Gesetz und all den daran geknüpften Verordnungen muss dazu nichts geändert werden, auf psychologischer Ebene aber könnte diese Praxis die Preisbildung der Unternehmen korrigieren. Mittelfristig nimmt mit dem faireren Preis der Spardruck beim Bauunternehmen ab. Bei der Abwicklung der Projekte und den Bauten selbst können die beauftragten Firmen damit wieder eine höhere Qualität bieten. «Das Akquirieren von neuen Aufträgen jedoch», so Lardi, «wird wieder schwieriger, weil nicht einfach der billigste Preis offeriert werden kann.»
Die Messlatte neu justieren
Ist eine solche Vergabepraxis legitim? Deckt sie sich mit den Anforderungen seitens einer öffentlichen Finanzkontrolle? «Eingegriffen wird immer mit dem Argument, auf Druck der Politik müsse der Staat sparen. Bei genauer Betrachtung stimmt das aber nicht», antwortet Benedikt Koch, der designierte Direktor des SBV. Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) hält fest, dass das «wirtschaftlich günstigste» Angebot den Zuschlag erhalten soll. Damit «günstig» nicht weiterhin mit «billig» gleichgesetzt wird, hat die Bauwirtschaft in der im Juli 2015 abgeschlossenen Vernehmlassung zum öffentlichen Beschaffungswesen vorgeschlagen, künftig vom «vorteilhaftesten Angebot» zu sprechen. Damit würde die Schweiz dem englischen Wortlaut des WTO-Übereinkommens folgen, der von einer Vergabe verlangt, dass diese «the most advantageous tender» berücksichtigen muss.
«Den gleichen Standpunkt vertritt seit Kurzem die Europäische Kommission», fügt Koch hinzu. Im Kontext eines funktionierenden Wettbewerbs betont die Exekutive der EU nicht nur die niedrigen Preise, sondern verweist auch explizit auf die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis. In einem solchen Umfeld spornt der Wettbewerb die Unternehmen dazu an, ihre Leistungen und Produkte zu optimieren. Die Qualität nämlich misst die EU-Kommission an der Lebensdauer und der Zuverlässigkeit eines Produkts sowie am Service und an der Kundenfreundlichkeit des Anbieters, wie der SBV-Direktor zusammenfasst. «Dieser wettbewerbspolitische Denkansatz dürfte ein gutes Vorbild für die Schweiz sein, auch wenn wir nicht zur EU gehören.» (Urs Rüttimann)
Den ausführlichen Beitrag über die Infratagung 2016 lesen Sie in Baublatt 6 vom 12. Februar.